Inhalt Stichwörter
| Kurier-, Express-, Postdienste | |
| Stand | Thema |
| 2007 | Briefmarken sind mehr als „Postwertzeichen” / Kunst auf kleinstem Raum |
| 2007 | Von der Idee zur Marke: Wie entstehen Briefmarken? |
| 2010 | Mitglieder des Programm- und des Kunstbeirats für die Ausgabe von Postwertzeichen benannt |
| 2010 | Ideenwettbewerb 2012: Wer oder was soll auf die Briefmarke? / Themenvorschläge erwünscht |
| November 2008 | Gutes tun - Mit Briefmarken helfen Ein Zeichen für gute Taten - ein neues Signet für Briefmarken seit 2008 |
| Januar 2010 | Kleiner Einsatz, große Wirkung - Sondermarken mit Zuschlag: Wohlfahrtsmarken, Jugendmarken, Umweltmarke, Philateliemarke |
| April 2010 | Intelligente RFID-Systeme - Auf dem Weg zum Internet der Dinge |
| 2009 | Was ist RFID? |
| 2009 | Zukunft des Briefes - Feature von Jörg Münchenberg, Deutschlandradio |
| Sept. 2012 | Adressenhandel und unerwünschte Werbung: Robinson-Liste |
| 22.07.2008 | Individualisierter Verbraucherschutz mit der DDV-Robinsonliste |
| Sept. 2012 | Werbung und Adresshandel |
| Juni 2013 | 3D-Druck Frisch aus dem Drucker - Die 3D-Technologie könnte die Logistik verändern. Risiko oder Revolution? |
| Juli/August 2015 | Deutsche Post DHL Group aktiv in internationalen Organisationen |
| Juli/August 2015 | Wie teuer darf ein Brief sein? Neue Preisberechnung beim Briefporto - Price-Cap-Entscheidung |
| Postbank | |
| Stand | Thema |
| 2008 | Meilensteine des Online-Banking |
| 2010 | Finanzen: Wie setzt sich die IBAN zusammen? |
| Telekommunikation | |
| Stand | Thema |
| 1984/2009 | Erste E-Mail in Deutschland 2. August 1984 / Erste De-Mail 8. Oktober 2009 |
| 2009 | Glasfaserkabel - Grundlage moderner Datenautobahnen |
| 2009 | Lokalisierung: Wo bin ich? - Lokalisierung über das Handynetz |
| 2009 | UMTS - die 3. Mobilfunkgeneration / 5 Jahre UMTS |
| 2009 | Navigation: Mit dem Handy gut ankommen |
| 2009 | Glasfaser-Seekabel sorgen für globale Vernetzung |
| 2009 | 10 Jahre Wettbewerb auf der „letzten Meile” / 14 Millionen Haushalte sind komplett zu neuen Anbietern gewechselt |
| 2009 | Vor 10 Jahren begann die Erfolgsstory DSL: 24 Millionen Breitbandanschlüsse in Deutschland |
| 2009 | Breitband: So werden IP-Netze schneller |
| 2009 | VDSL - das Breitbandnetz der Zukunft |
| 2009 | Die Glasfaser-Techniken: HYTAS |
| 2009 | IPTV: Der Zuschauer wird zum Programmdirektor |
| 2009 | Datenübertragung - Auf der Überholspur mit hoher Bandbreite |
| 2009 | 50 Jahre CEPT: Pionier des GSM-Mobilfunkstandards feiert Geburtstag |
| 2009 | WAP - 10 Jahre mobiles Internet |
| 2009 | Android |
| 2009 | Videokompression: Handy TV-fähig durch Videokompression |
| 2009 | Verkehrsinformationssysteme: Staufrei durch Stadt und Land |
| 2009 | USB Modem: Das Innenleben eines Daten-Sticks |
| 2009 | Machine-to-Machine: Wenn Maschinen miteinander kommunizieren |
| 2009 | Rundfunktechnik DVB: Digital fernsehen und Radio hören / Die neue digitale Fernsehnorm heißt Digital Video Broadcasting (DVB) |
| 2009 | HDTV - Digitales Fernsehen |
| 2009 | Rundfunktechnik: HDTV ante portas |
| 2009 | HDTV bei ARD, ZDF, ORF, SRG und arte in bester Qualität |
| 2009 | Hybrid-TV |
| 2009 | Mobilfunk-Basisstationen: Ohne Festnetz funktioniert auch das Handy nicht |
| 2009 | Mit dem Handy bezahlen: sicher und bequem |
| 2009 | Handys und Basisstationen: Was ist der SAR-Wert? |
| 2009 | Hochleistungscomputer in Miniaturform: Wie sieht ein Smartphone von innen aus? |
| 2009 | Aus zwei mach eins: Mit Handys überall Musik hören |
| 2009 | Erste private deutsche GSM-Lizenz wird 20 Jahre alt |
| Febr. 2010 | Apps im Alltag: Fit und schlank mit dem Handy |
| 2010 | Über 10 Millionen E-Mails im Monat |
| 2010 | Die Frequenz |
| 2010 | Weltfernmeldetag |
| 2010 | Zugang: Mit Hochgeschwindigkeit auch ohne Kabel ins Web |
| 6. Mai 2010 | Das Wohnzimmer wird zum 3D-Kino / Auftakt der Eishockey-WM am 7. Mai 2010 in 3D |
| 11. Februar 2011 | 1 Jahr öffentlich-rechtliches Fernsehen in HD-Qualität - Tipps für den Einstieg ins hochauflösende Fernsehen |
| 7. September 2011 | 150 Jahre Telefon - Meilensteine: Vom Hebdrehwähler bis zum Smartphone |
| 7. September 2011 | „Wussten Sie schon, dass...” Kurioses und Interessantes aus 150 Jahren Telefon |
| Oktober 2011 | Umfrage zu Telefon 2011 |
| 30. Juni 2012 | 20 Jahre Mobilfunk - 1992 bis 2012 - Quelle: Vodafone |
| 30. Juni 2012 | 20 Jahre Mobilfunk - 1992 bis 2012 - Quelle: Deutsche Telekom |
| 2012 | „Ich sehe was, was Du nicht siehst” - QR-Code: ein gerastertes Quadrat |
| 11.09.2012 | Faszinierend und innovativ: Wie M2M die Welt verändert |
| 08.07.2012 | Vor 50 Jahren startete das Satellitenfernsehen |
| 28.08.2012 | Beste Bildqualität für Flachbildfernseher |
| 25.08.2012 | E-Plus: Mobiles Internet per Smartphone Mobiles Internet: Wie das WWW aufs Handy kommt |
| 06.09.2012 | Internet der Dinge oder: Das ewige Gleichnis vom schlauen Kühlschrank |
| 19.10.2012 | M2M: Wenn die Kuh per SMS den Bauern ruft |
| 30.04.2013 | Das WWW wird 20 Jahre alt |
| 06.06.2013 | Das Handy wird 30 |
| 16.09.2013 | Erste Hilfe Notrufsäule Smartphone |
| 19.09.2013 | 40 Jahre Notruf 112: So wird das Handy zum Lebensretter |
| 21.02.2014 | Mobilfunk: Blick in die Zukunft - 5G |
| 2014 | Mobiles Bezahlen/Mobile Payment: Bezahlen mit dem Smartphone - Das Smartphone wird zur Brieftasche
|
| 2014/2015 | Was ist IP-basierte Telefonie
|
| 2014 | Keine Angst vor IP - Telekom schaltet bis 2018 das Netz komplett um |
| 09.11.2015 | Die Webseite wird 25 Jahre alt |
Stichwörter: Kurier-, Express-, Postdienste
Briefmarken sind weit mehr als reine „Postwertzeichen” / Kunst auf kleinstem Raum03.08.2007
Briefmarken sind bunte Spiegel unserer Alltagskultur. Sie erzählen von Menschen, die Herausragendes geleistet haben und erinnern an Ereignisse, die wir nicht vergessen dürfen. Insofern ist eine Briefmarke ein Medium, das Zeichen setzt.
Briefmarken sind Ministersache
Was nicht jeder weiß: Herausgeber der Briefmarken ist das Bundesministerium der Finanzen, verkauft werden sie derzeit von der Deutschen Post. Früher übernahm der Postminister diese Aufgabe, seit 1998 ist der Finanzminister zuständig. Rund 100 Grafiker sorgen dafür, dass jede Marke zum einzigartigen Meisterstückchen wird.

Sondermarke „200 Jahre Blindenschule Berlin”, Ausgabetag: 2. März 2006
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Repräsentanten unserer Kultur und Gemeinschaft
Rund 50 Sondermarken erscheinen jährlich. Jeweils in einer Auflage von rund 10 Millionen. Auf ungefähr 3,5x3,5 cm zeigen sie anschaulich, was die Republik heute ausmacht und damals bewegte: ob Handballweltmeisterschaft (2007), Sorge um den Weltfrieden (1984) oder die Freude über das Fernsehen (1957).
Gemeinschaftsmarken, die Deutschland regelmäßig zusammen mit einem anderen Land herausgibt, erinnern darüber hinaus an nationenverbindende Personen und Ereignisse. Solche Briefmarken sind Botschafter der Freundschaft.
Kleine Wohltäter
Jedes Jahr gibt das Bundesfinanzministerium außerdem 15 Sondermarken heraus, für die zusätzlich zum Porto ein Zuschlag erhoben wird. Die kleinen Beträge von 20 bis 55 Cent kommen einem guten Zweck zugute: sozialen Hilfsprojekten, der Jugendhilfe, der Sporthilfe, dem Umweltschutz und der Stiftung für Philatelie- und Postgeschichte. Rund 11 Millionen Euro kommen so Jahr für Jahr zusammen. Eine große Leistung - erreicht mit sympathischen Mitteln.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Von der Idee zur Marke: Wie entstehen Briefmarken?
Juli 2007
Früher entschieden die Landesfürsten allein darüber, was auf einer Briefmarke zu sehen ist. Heute kann jedermann Themen vorschlagen. Jährlich gehen etwa 800 Anregungen beim Finanzministerium ein. Rund 50 haben die Chance, verwirklicht zu werden. Das letzte Wort hat der Bundesfinanzminister. Die Auswahl folgt nach einem klar definierten Kriterienkatalog.
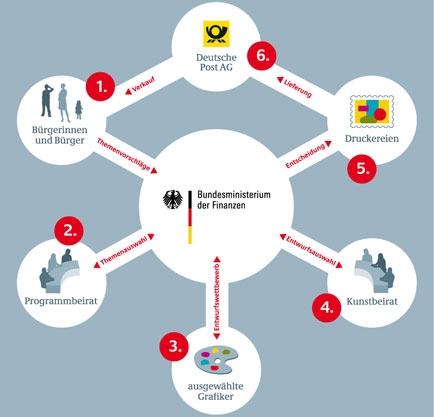
Die Entstehung einer Briefmarke / © 2008 Bundesministerium der Finanzen
Geburtshelfer der Briefmarke
Die deutschen Briefmarken sollen Deutschland repräsentieren - doch was macht unser Land aus? Bei der Beantwortung dieser Frage unterstützen den Bundesfinanzminister 2 Gremien, in denen Politiker sitzen, Verwaltungsfachleute, Grafiker, Philatelisten (Briefmarkensammler) und Vertreter der Post:
- Der Programmbeirat macht sich Gedanken über die Themen der Briefmarken, prüft die Anregungen aus der Bevölkerung für neue Briefmarken und stellt eine Vorschlagsliste für die Neuerscheinungen eines Jahres zusammen.
- Der Kunstbeirat beurteilt die grafische Qualität der Entwürfe. 1954 wurde der Kunstbeirat zum ersten Mal einberufen, nachdem es harsche Kritik an der Gestaltung der Briefmarken der jungen Bundesrepublik gehagelt hatte.
Der Programmbeirat - 14 Mitglieder (Stand 2009) - setzt sich aus Journalisten, Philatelisten, Verwaltungsfachleuten, Postmitarbeitern und 4 Mitgliedern des Bundestages zusammen. Unter Hunderten von Anregungen aus der Bevölkerung wählt er die wichtigsten Themen aus. Dabei sind Ereignisse von lokaler Bedeutung ebenso ausgeschlossen wie Abbildungen lebender Personen (Ausnahme: die Bundespräsidenten). Es bleiben aber noch viele aktuelle Anlässe aus allen Bereichen des Lebens übrig, die die Neuausgaben zieren könnten. Ein Teil des Programms steht von vornherein fest, zum Beispiel alle Wohlfahrts-, Jugend- und Sportzuschlagsserien.
Nach der Entscheidung des Programmbeirats über das Ausgabeprogramm eines Jahres ist der Kunstbeirat am Zug, seine Auswahl aus den Entwürfen zu treffen. Ihm gehören 14 Experten an, u.a. namhafte Graphiker, 2 vom Deutschen Bundestag benannte Personen, Philatelisten und Verwaltungsfachleute (Stand 2009).
Wenn das Thema feststeht, werden verschiedene Grafiker eingeladen, einen Entwurf abzugeben. Rund 100 Grafiker kümmern sich derzeit um die Gestaltung der deutschen Briefmarken. Für jede neue Marke bittet das Finanzministerium 6 bis 8 von ihnen, einen Entwurf abzugeben. Auf einer Fläche von nur wenigen Quadratzentimetern wird jeder Entwurf liebevoll ausgestaltet. Das macht die einzelne Marke zum kleinen Kunstwerk.
Sanne Jünger ist eine von rund 100 Designerinnen in Deutschland, die Briefmarken gestalten. Keine einfache Aufgabe. Auf kleinstem Raum ein Thema gekonnt umzusetzen, ist eine Kunst für sich. Sanne Jünger, Grafikerin: „Bei der Gestaltung einer Briefmarke gibt es für mich 2 Schwerpunkte: Der eine Schwerpunkt ist, dass ich das Thema plakativ, populär darstelle, und das zweite ist, dass ich einen Hingucker schaffe.”
Welche Entwürfe wirklich ein Hingucker sind, darüber urteilt der Kunstbeirat. 3-mal im Jahr treffen sich 12 Experten. Sie diskutieren die künstlerische Umsetzung und wägen ab, ob ein Motiv grafisch gut gestaltet ist und Käufer anspricht. Das letzte Wort bei allen Entscheidungen hat der Bundesfinanzminister. Er muss jedem Thema und jedem Motiv zustimmen. Besonders am Herzen liegen dem Minister Marken, die auf soziale Aspekte eingehen.
Etwa 3 Milliarden Briefmarken werden jährlich in hoch spezialisierten Wertdruckereien gedruckt und in den Verkaufsstellen der Post in ganz Deutschland verkauft. Wohlfahrtsmarken sind ein unkomplizierter Weg, um mit kleinen Summen Großes zu bewirken. Etwa 20 Millionen Euro kommen durch sie jedes Jahr wohltätigen Projekten zugute. Ob mit Zuschlag oder ohne, jede einzelne Briefmarke ist eine kleine Kostbarkeit, die für Deutschland Zeichen setzt.
Der Video-Clip „Von der Idee zur Marke” - Stand 2009 - macht anschaulich, wie Briefmarken entstehen.
Seit 1998 - nach Auflösung des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation - gibt der Bundesfinanzminister auch Briefmarken heraus. Die kleinen Kunstwerke mit dem gezackten Rand erzählen viel über unsere Zeit. Der Film (4.06 Minuten) erzählt, wie eine Marke entsteht.
Der Film entstand in der Zeit der großen Koalition aus CDU/CSU/SPD (2005 - 2009), als Peer Steinbrück (SPD) Bundesfinanzminister war.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen (2009)
© BFM (2009)
Mitglieder des Programm- und des Kunstbeirats für die Ausgabe von Postwertzeichen benannt04.03.2010
Bei der Frage, für welche Themen offizielle Sonderpostwertzeichen herausgegeben werden sollen, lässt sich der für die Ausgabe von Postwertzeichen zuständige Bundesfinanzminister alljährlich von einem Programmbeirat beraten und eine Vorschlagsliste vorlegen. Bei der Auswahl der Künstler-Entwürfe für die Sonderpostwertzeichen berät ein Kunstbeirat.
Der Programmbeirat besteht aus 14 Mitgliedern, 2 stellt das Bundesfinanzministerium selbst, 2 kommen aus dem Kreis der Brief-Lizenznehmer, 4 sind Abgeordnete des Deutschen Bundestags, 1 wird vom Bund Deutscher Philatelisten benannt, 1 vom Bundesverband des Deutschen Briefmarkenhandels. Außerdem sind vertreten 1 Experte Geschichte/Medien, 1 Beauftragter für Kultur und Medien der Bundesregierung, 1 Vertreter des Deutschen Presserats und 1 Mitglied der Kultusministerkonferenz.
Der Kunstbeirat besteht aus 14 Mitgliedern: 2 Angehörige des Bundesfinanzministeriums, 2 Vertreter der Lizenznehmer, 2 Bundestagsabgeordnete, 1 Vertreter des Bundes Deutscher Philatelisten, 1 Vertreter des Bundesverbandes des Deutschen Briefmarkenhandels und 5 Grafik-Experten und 1 Experte für Drucktechnik.
Der Bundesfinanzminister beruft die Mitglieder der beiden Beiräte für die Dauer einer Legislaturperiode. Anfang März 2010 gab das Bundesfinanzministerium die Mitglieder der beiden Gremien für die 17. Legislaturperiode bekannt.
Und hier die Mitglieder des Programm- und des Kunstbeirats für die 18. Legislaturperiode (2013 - 2017):
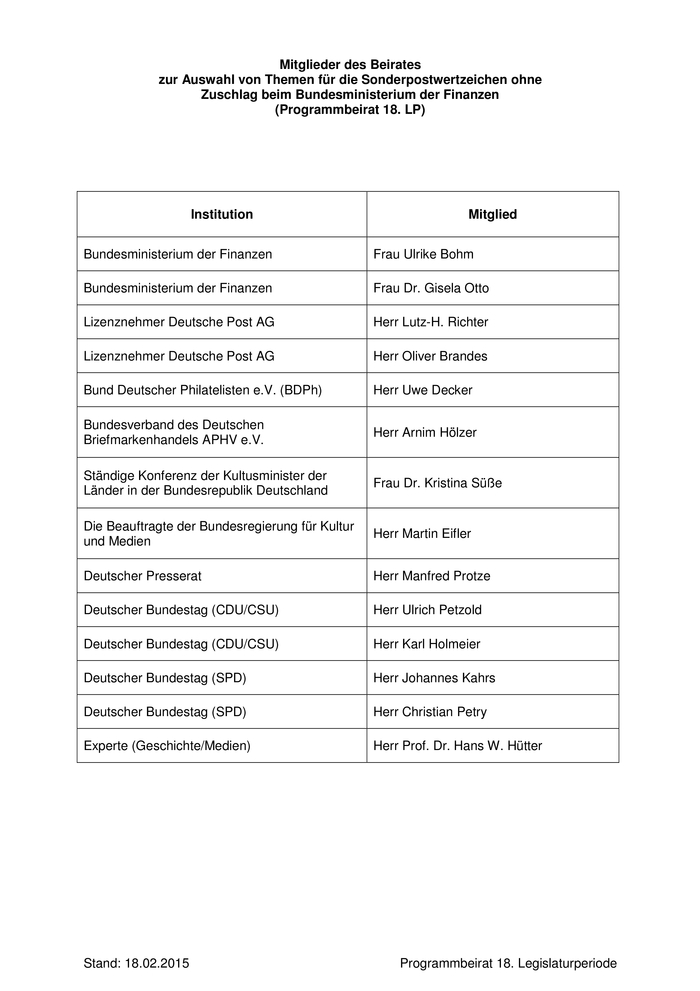
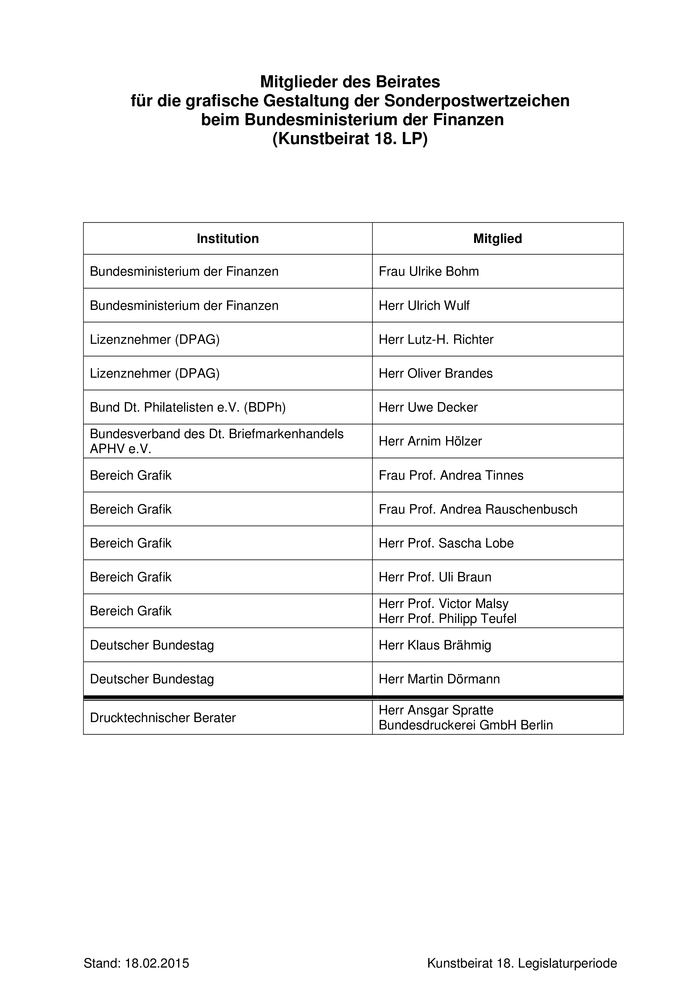
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Ideenwettbewerb 2012: Wer oder was soll auf die Briefmarke? /Themenvorschläge erwünscht
Januar 2010

Markenentwürfe / Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Briefmarken sind kleine Botschafter unseres Landes, unserer Kultur und Geschichte. Damit dies auch so bleibt, hat das Bundesfinanzministerium Kriterien für die Auswahl der Themen definiert.
Die Marken sollen z. B. nicht nur klaren Bezug zu Deutschland haben, sondern auch ausgewogen auf die Bereiche „Staat und Gesellschaft”, „Kunst und Kultur”, „Wissenschaft und Technik”, „Natur und Umwelt” sowie „Internationales” eingehen. Innerhalb dieser Vorgaben sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Bestimmen Sie mit, wovon die neuen Marken erzählen sollen!
Ulrike Bohm, Leiterin des Referats Postwertzeichen im Bundesfinanzministerium: „Wir haben dazu extra einen Ideenwettbewerb ins Leben gerufen, der die Bürger ermuntern soll, sich noch aktiver am Entstehungsprozess und Auswahlverfahren zu beteiligen. Wir bekommen dazu über 1.000 Vorschläge im Jahr, die wir allesamt recht sorgfältig prüfen.”
Welche Ideen eine Marke wert sind, darüber diskutiert einmal im Jahr der Programmbeirat. Die Experten aus Politik und Gesellschaft wählen Themen aus, die vor allem eines sein müssen: besonders.
Briefmarken sollen Deutschland und seine kulturelle Vielfalt widerspiegeln. Dazu gehören auch bedeutende Persönlichkeiten. Zu Lebzeiten schaffen es allerdings nur die wenigsten auf eine Marke. Carl-Heinz Schulz, Ehrenpräsident des Bundesverbandes des Deutschen Briefmarkenhandels: „Wir haben 2007 eine Ausnahme gemacht, dass wir den Papst zu seinem 80. Geburtstag aufgrund seiner deutschen Herkunft gewürdigt haben. Das soll auch eine Ausnahme bleiben. Und nun haben wir zum ersten Mal noch eine Ausnahme besonderer Art gemacht, indem wir einen landesweit bekannten Eisbären auf die Marke gebracht haben.”
Schritt 1: Überlegen Sie
- Welche Persönlichkeit hat Sie beeindruckt?
- Welches Ereignis hat Sie bewegt?
- Welche Idee hat Sie begeistert?
- Welche Organisation, Bewegung oder Einrichtung hat Sie fasziniert?
Schritt 2: Schreiben Sie uns
Schreiben Sie an das Bundesministerium der Finanzen unter dem Stichwort „Zeichen setzen”, was auf Ihrer Marke zu sehen sein soll und warum. Die besten Chancen haben Sie, wenn Sie 3 Dinge beachten:
- Schlagen Sie keine lebenden Personen vor - diese dürfen in aller Regel nicht auf deutschen Briefmarken abgebildet werden.
- Wählen Sie ein Thema, das einen Bezug zu Deutschland hat und von überregionaler Bedeutung ist. Jubiläen sollten „rund” sein.
- Verzichten Sie auf parteipolitische oder kommerzielle Themen.
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Wettbewerb ist offen für alle, jede Idee ist willkommen. Sämtliche eingehenden Vorschläge werden vom Bundesfinanzministerium geprüft. Die überzeugendsten Vorschläge werden im Jahresprogramm 2012 umgesetzt. Die Gewinner erhalten jeweils ein Album mit der vollständigen Postwertzeichensammlung eines Jahres. Bei mehreren thematisch identischen Vorschlägen entscheidet das Los.
Unter allen Gewinnern werden zusätzlich 3 Sonderpreise verlost: jeweils eine Einladung zu einer offiziellen Präsentation, bei der eine Briefmarke erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird.
Teilnahmeschluss ist der 15. September 2010. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Quelle: Bundesfinanzministerium
Gutes tun - Mit Briefmarken helfen
Ein Zeichen für gute Taten - ein neues Signet für Briefmarken seit 2008
05.11.2008
Zeichen setzen für gute Taten
Die Sondermarken, die seit Jahrzehnten gemeinnützige Projekte und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land fördern, erhalten seit der Herausgabe der Weihnachtsmarken 2008 ein „Pluszeichen”.
![]()
Mit diesem Signet will das Bundesministerium der Finanzen als Herausgeber der deutschen Sondermarken erstens ein Zeichen setzen für das Ehrenamt in unserem Land und zweitens auf den guten Zweck der Cent-Spende beim Briefmarkenkauf hinweisen. Damit wird noch deutlicher, dass der Erwerb dieser Sondermarken mit einem „Plus” von wenigen Cent eine ganz persönliche gute Tat mit großer Wirkung ist. Wie bisher unterstützen die Cent-Erlöse in der Summe zahlreiche gemeinnützige Projekte. Dabei geht es um eine Größenordnung von rund 11 Millionen Euro pro Jahr.
Die Marke mit dem „Plus”
 Das Signet wurde von Prof. Schmitz aus Wuppertal entworfen. Wesentliches Merkmal ist die Kombination von Bild- und Wortelementen. Die Zusammensetzung aus Punkten leitet sich aus der Perforation der Markenbögen ab.
Das Signet wurde von Prof. Schmitz aus Wuppertal entworfen. Wesentliches Merkmal ist die Kombination von Bild- und Wortelementen. Die Zusammensetzung aus Punkten leitet sich aus der Perforation der Markenbögen ab.
Das „Plus” vor dem Cent-Wert steht für den besonderen Mehrwert dieser besonderen Marken.


Das komplette Zeichen wird auf dem Zehnerbogenrand aller Plusmarken abgebildet. Hier wird die Botschaft, wofür das Plus steht (Gutes tun) und womit es erreicht werden kann (Mit Briefmarken helfen), vermittelt. Die Kommunikation dieser Botschaft wird durch den Slogancharakter des Textes verstärkt.
Jeder Cent ist gut angelegt
Das Zeichen bürgt dafür, dass jeder Cent gut angelegt ist und direkt bei den Menschen ankommt, die auf die Solidarität unserer Gesellschaft angewiesen sind. Die Bundesarbeitgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. konnte viele Projekte mit Spendengeldern aus dem Verkauf von Plusmarken fördern. Darum gilt für jeden, der Plusmarken kauft: Jeder persönliche Einsatz ist ein Gewinn, ein echtes Plus für uns alle. Durch den Kauf der Briefmarken mit dem Plus setzen Sie ein ganz persönliches Zeichen für Hilfe, die ankommt.
Quelle: Text, Fotos und Grafiken: Bundesministerium der Finanzen
Hier finden Sie ein Video der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW): „Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble präsentiert die Wohlfahrtsmarken 2010 - die Duftmarken - bei Bundespräsident Horst Köhler”.
Kleiner Einsatz, große Wirkung - Sondermarken mit Zuschlag:
Wohlfahrtsmarken, Jugendmarken, Umweltmarke, Philateliemarke
Januar 2010
- Wohlfahrtsmarken helfen Menschen in Not

Kind im Krankenhaus auf der Bult in Hannover, mit Siegfried
Quelle: MediaCompany / Bundesfinanzministerium
Die Kinder im Krankenhaus auf der Bult in Hannover freuen sich, wenn Siegfried kommt, der freundliche Mann mit dem grauen Bart. Wenn der da ist, spielt er mit ihnen Quartett, Spielzeugautos, Memory. Siegfried ist einer von 70 Ehrenamtlichen, die regelmäßig in die Klinik kommen und Freude verbreiten - Lebensfreude, die wichtig ist für die Genesung. Die Spielsachen und Bastelmaterialien finanziert das Krankenhaus über den Verkauf von Wohlfahrtsmarken. Dadurch kommen jedes Jahr rund 700 Euro zusammen - ein kleiner Beitrag mit heilender Wirkung.
Wohlfahrtsmarken
Wohlfahrtsmarken gibt es in Deutschland bereits seit 1949. Jedes Jahr wird eine Serie von 4 Marken mit je einem zusätzlichen Cent-Anteil herausgegeben. Die Porto- und „Pluswerte” betragen 45 + 20 Cent, 55 + 25 Cent und 145 + 55 Cent. Seit 1969 erscheinen darüber hinaus noch jährlich 2 Weihnachtsmarken mit Werten von 45 + 20 Cent und 55 + 25 Cent.

Die Erlöse aus den Plusanteilen der Wohlfahrts- und Weihnachtsmarken fließen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. zu. Unter ihrem Dach sind die 6 Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossen (Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband, Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland, Deutsches Rotes Kreuz, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband und Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland). Seit 1949 wurden fast 4 Milliarden Wohlfahrts- und Weihnachtsmarken mit einem Pluserlös von rund 600 Millionen Euro verkauft.
Am 7. Januar 2010 präsentierte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die Wohlfahrtsmarken 2010, die ersten deutschen Briefmarken mit Duft von Apfel, Erdbeere, Zitrone und Heidelbeere, der Öffentlichkeit und übergab Bundespräsident Horst Köhler, dem Schirmherrn des Sozialwerks Wohlfahrtsmarken, die ersten Drucke. Einen Video-Clip von der Präsentation sehen Sie hier
Jugendmarken
Seit 1962 werden sogenannte Jugendmarken herausgegeben. Mit den „Plus”-Erlösen werden „Maßnahmen zum Wohle junger Menschen” gefördert. Das kann ein Jugendtheater sein, die Sanierung eines Jugendheims oder ein historisch-politisches Jugendbildungsprojekt. Was im Einzelnen gefördert werden soll, darüber entscheidet die Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V.
Sportmarken
In der Plusmarkenserie „Für den Sport” erscheinen jährlich 4 Briefmarken. Die Pluserlöse fließen in die Förderung des Spitzen- und Leistungssports. Verwaltet wird das Geld von der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Die Sporthilfe vergibt Stipendien, bezahlt Nachhilfestunden, springt bei trainingsbedingten Verdienstausfällen ein oder hilft beim Kauf von Sportgeräten. Derzeit betreut die Stiftung 3.800 Spitzen- und Nachwuchsathleten sowie 600 junge Talente. Sportmarken gibt es seit 1968.

Umweltmarke
Ein besonderes „Marken”-Zeichen ist die seit 1992 alle 2 Jahre erscheinende Sondermarke mit einem zusätzlichen Cent-Anteil zugunsten des Umweltschutzes. Empfänger dieser Erlöse ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, das damit nationale und internationale Umweltschutzprojekte fördert.
Philateliemarke
In dem Jahr, in dem keine Umweltmarke erscheint, gibt es eine Plusmarke zugunsten der Stiftung für Philatelie- und Postgeschichte. Der Zusatzerlös hilft, die Briefmarke als historisches Kulturgut unseres Landes zu fördern. Diese Plusmarke gibt es seit 1993.

| Empfänger der Zusatzerlöse | Erlöse gesamt (Millionen Euro) seit 1949 |
| Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V | rd. 600 |
| Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V. | rd. 200 |
| Stiftung Deutsche Sporthilfe | rd. 130 |
| Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit | rd. 6 |
| Stiftung zur Förderung der Philatelie und Postgeschichte | rd. 10 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Intelligente RFID-Systeme – Auf dem Weg zum Internet der Dinge
April 2010

Foto: Deutsche Post AG
Sie werden immer kleiner und leistungsfähiger und schon sind sie aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: die RFID-Chips. In der Organisationseinheit DHL Solutions & Innovations der Deutschen Post DHL nimmt die Erprobung und Weiterentwicklung der RFID-Komponenten und ihrer Einsatzmöglichkeiten einen großen Stellenwert ein. Eigentlich kennt jeder die Radiofrequenz Identifikation, kurz RFID, vom berührungslosen Skipass oder der elektronischen Wegfahrsperre im Auto. Aber RFID-Systeme können noch mehr. Zum Beispiel Informationen über ein Produkt, eine Palette oder ganze Lagerbestände senden. Diese müssen, anders als beim Barcode, nicht umständlich mit Lesegeräten gescannt werden. Die Informationen werden per Funk übertragen: schnell, automatisch und ohne direkten optischen Kontakt. Das funktioniert, weil RFID-Chips Informationen sammeln, senden und gegebenenfalls Folgeprozesse anstoßen können. Durch diese technologischen Erfolge und Einsatzszenarien wird die Entwicklung des Internets der Dinge maßgeblich vorangetrieben. Eine aktive Kommunikation zwischen Gütern und Akteuren in der Logistik wird Realität.
Schon seit den 1950er Jahren wird die RFID-Technologie genutzt. Aber erst seit 10 Jahren arbeiten Forscher und Nutzer gezielt daran, die Technologie für den kommerziellen Einsatz in der Industrie, im Handel und bei Dienstleistern zu erschließen. Die Deutsche Post DHL war von Anfang an dabei und ist - noch einmal verstärkt durch die Gründung des Innovationsbereiches innerhalb des Unternehmens - zusammen mit den Herstellern maßgeblich an der Weiterentwicklung der RFID-Technologie beteiligt. Und zwar in enger Zusammenarbeit mit globalen Partnern wie IBM, Motorola, SAP, T-Systems, Oracle, mittelständischen Technologieanbietern wie 7ID oder Tricon und Forschungsinstituten wie zum Beispiel den Fraunhofer Gesellschaften. Oberstes Ziel ist die Erarbeitung von Lösungsstandards, die problemlos in globale Netzwerke eingebunden werden können. DHL Solutions & Innovations hat im eigenen Konzern alle Voraussetzungen dafür geschaffen, RFID in den Zielindustrien zu etablieren. Durch eine abgestimmte und gemeinsame Umsetzung der Technologie profitieren zukünftig die Kunden von DHL von erhöhter Transparenz durch Echtzeitinformationen, verringerten Zugriffszeiten, Prozessoptimierungen sowie neuen Business-Logiken.
Es gibt bereits eine Reihe von Großkunden, die beim Einsatz von RFID auf die Innovation von DHL setzen. Beispiele:
- Sony: Der Elektronik-Konzern stattet alle Kartons und Paletten im eigenen Zentrallager Tilburg (Niederlande) mit RFID-Tags aus. Die Paletten werden beim Warenausgang, d. h. bei der Übergabe an DHL Freight, durch RFID-Gates auf Artikelebene erfasst. Bei der Entladung wird die eingehende Ware an 3 RFID-Gates erneut automatisch ausgelesen. Sowohl Diebstahl als auch die Einschleusung von Plagiaten in den Handel kann so identifiziert und effektiv verhindert werden.
- Metro Cash & Carry Frankreich: Hier hat DHL erstmalig eine flächendeckende RFID-Lösung für einen Handelskonzern entwickelt und eingesetzt. DHL ist für das gesamte Warenmanagement der 91 Metro-Märkte in Frankreich zuständig. Es geht um jährlich 1,3 Millionen Paletten.
Längst hat man auch die Einsatzmöglichkeiten in der Kühllogistik gesehen und bedient sich wachsend dieser Technologie. Es gibt RFID-Chips, die auch die Einhaltung der Kühltemperaturen während der Transportkette überwachen und bei kritischen Veränderungen notfalls Alarm auslösen. Die RFID-Lösung „SmartSensor Temperature” wurde von DHL Solutions & Innovations entwickelt und wird stetig verbessert und erweitert, etwa zur Überwachung von Luftfeuchtigkeit und Erschütterungen beim Warentransport.
Noch vor einigen Jahren gab es eine lebhafte Diskussion zum Thema Datenschutz beim RFID-Einsatz. Theoretisch könnte die Technik benutzt werden, um z.B. Kleidung mit Chips auszustatten und den Träger zu überwachen. Für die Logistikanwendungen in Transport und Lager geht es um den Informationsfluss von Waren und nicht um die elektronische Überwachung von Personen. Darum stellte auch der Bundesdatenschutzbeauftragte richtig, dass RFID datenschutzrechtlich nicht problematisch sei, „sofern keine Verknüpfung mit personenbezogenen Identifikationsdaten erfolgt.”
Wie funktioniert RFID? Sehen Sie hier einen Clip der Deutschen Post AG:
2008 © Deutsche Post AG
Quelle: Deutsche Post AG / Postforum April 2010
Was ist RFID?
2009
 RFID steht für Radio Frequency Identification (Identifikation über Radiowellen)
RFID steht für Radio Frequency Identification (Identifikation über Radiowellen)
Die Aufgabe der RFID-Systeme ist im Grunde dieselbe, die heute überwiegend noch der Barcode erledigt: Er stellt Informationen über ein Produkt, eine Palette oder ganze Lagerbestände bereit. Dabei sind RFID-Systeme aber dem Barcode in vielerlei Hinsicht überlegen. Zum Beispiel ist es möglich, viele Produkte auf einmal, ohne Sichtkontakt, auszulesen.
Ein RFID-Etikett besteht aus einem Microchip, der mit einer kleinen Antenne verbunden ist. Die Antenne überträgt die Informationen zu einem Lesegerät, dem sogenannten RFID-Reader. Auf dem Microchip können deutlich mehr Informationen gespeichert werden als auf einem Barcode-Etikett - bis zu mehrere Kilobytes. Der entscheidende Vorteil von RFID ist, dass die Daten nicht mehr umständlich mit Scannern ausgelesen werden müssen, sondern alles per Funkübertragung geschieht: schnell und ohne direkten Kontakt.
Während Barcodes stets einzeln ausgelesen werden müssen, können RFID-Chips zeitsparend „im Pulk” ausgelesen werden. Das ermöglicht zum Beispiel in der Lagerlogistik eine Inventur auf Knopfdruck. Die Möglichkeiten von RFID in der Logistik sind sehr vielfältig und eröffnen der Branche völlig neue Perspektiven. Finden Sie heraus, was RFID heute und in Zukunft alles leisten kann.

Kluge Medikamente
Viele Produkte müssen gekühlt transportiert werden. Dazu gehören Lebensmittel, Flüssigmedikamente oder Kosmetika. Ein im DHL Innovation Center entwickelter, mit Temperaturfühlern ausgestatteter RFID-Sensor-Tag überwacht die Ware und ihre Temperatur während des gesamten Transports.
Die Messdaten stehen an jedem Auslesepunkt zur Verfügung. Absender, Empfänger oder Kontrolleur können den Zustand der Produkte überprüfen, ohne dass die Sendung geöffnet werden muss. Überdies kann der Chip jederzeit das Mindesthaltbarkeitsdatum des Produkts neu berechnen. Nicht mehr verwendungsfähige Waren könnten im Notfall deshalb sofort aus der Lieferkette genommen werden.
 Smarte Container
Smarte Container
Ein vom DHL Innovation Center entwickelter Prototyp eines intelligenten Containers überwacht mittels RFID, wie stark die Ware während des Transports Feuchtigkeit, Stößen und Erschütterungen ausgesetzt ist. Die im Container befindlichen Sensor-Tags übermitteln anschließend diese Informationen mittels GPS oder anderer Technologien. Sollte die Ware beeinträchtigt sein, kann frühzeitig Ersatz geordert werden.
Intelligente Pakete
 Bislang werden die Wege von Paketen, Briefen oder Containern zentral gesteuert. Das könnte sich zukünftig ändern. Die Fracht von morgen nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Die Vision ist, ein Paket mit Wissen auszustatten, so dass es sich seinen eigenen Weg suchen kann. Die Zielinformationen werden in einem RFID-Tag gespeichert, der am Paket angebracht ist.
Bislang werden die Wege von Paketen, Briefen oder Containern zentral gesteuert. Das könnte sich zukünftig ändern. Die Fracht von morgen nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand. Die Vision ist, ein Paket mit Wissen auszustatten, so dass es sich seinen eigenen Weg suchen kann. Die Zielinformationen werden in einem RFID-Tag gespeichert, der am Paket angebracht ist.
Die Anlage steuert also nicht mehr das Paket, sondern das Paket steuert die Anlage. Es bewegt sich zielsicher von allein in einem riesigen Logistik-Netzwerk. Fachleute sprechen vom „Internet der Dinge”, denn das Prinzip ähnelt dem digitalen Daten-Highway, auf dem die Datenpakete von E-Mails und Co. selbstständig ihren Weg finden.
RFID ist eine große Chance für die Logistik, den Paketversand zu vereinfachen und Logistikprozesse noch effizienter zu gestalten.
Text und Grafiken: Deutsche Post AG
Am 21. Dezember 2009 beleuchtete Deutschlandradio in einem Feature von Jörg Münchenberg die Zukunft des Briefes. Hier die Niederschrift und die Audiodatei des Sendungstextes mit freundlicher Genehmigung des Autors und des Senders
Zukunft des Briefes - ein Feature von Jörg Münchenberg
E-Mail statt Papier und Tinte
Der schleichende Tod des Briefes
21.12.2009
Gerade zum Ende des Jahres bekommt die Post viel zu tun: Zahlreiche Weihnachtsgrüße wollen transportiert werden. Doch immer mehr wird auch elektronisch verschickt, als E-Mail. Und nicht nur an Weihnachten verliert der Brief seine Bedeutung.

Künftig nur noch leer? Eine Reihe von Briefkästen an einer Hauswand.
Foto: Deutschlandradio/Stock.XCHNG/Grethe Boe)
Hagen Flosdorf auf der morgendlichen Tour durch seinen Zustellbezirk in der Kölner Innenstadt. 6 Tage in der Woche, bei jedem Wetter. Briefträger müssen robust sein:
„Ja, man gewöhnt sich ja mit der Zeit dran. Das ist dann nicht mehr so schlimm wie es das für andere ist. Die aus dem Büro sind. Die sagen mir dann schon öfters: ach, Sie Ärmster. Aber für mich ist das dann gar nicht mehr so. Der letzte Winter war mal extrem. Aber Gott sei Dank haben wir die ja nicht mehr jedes Jahr. Wenn es kalt und trocken ist, dann geht es. Schlimmer ist, wenn es permanent regnet.”
Der Ende-40-Jährige macht seine Arbeit bei der Post gerne, er ist seit 29 Jahren dabei. Erst im Innendienst, seit 10 Jahren trägt er Briefe aus. Postbote, sagt Flosdorf, ist mehr als ein gewöhnlicher Job:
„Normalerweise ist das ein Beruf wie jeder andere. Aber, bei gewissen Situationen bemerkt man, es ist ja doch ein bisschen anders. Letztens ist bei einer Kundin der Hund gestorben. Und da kann man da nicht einfach so vorbeigehen. Da unterhält man sich mit ihr. Da gibt man ein bisschen Trost und lässt sie erzählen. Da merkt man dann - aha, es ist ja doch mehr als nur Briefe verteilen.”
Jetzt, kurz vor Weihnachten herrscht Hochbetrieb. Die Post muss Sonderschichten fahren, um den Ansturm zu bewältigen. Pakete, Päckchen, Wunschkarten und Briefe - das Geschäft für den Monopolisten Deutsche Post brummt, der trotz Liberalisierung noch immer 90 Prozent des Briefmarktes beherrscht. Doch von Feierstimmung ist in den Führungsetagen nichts zu spüren - im Gegenteil:
„Also grundsätzlich ist es so, dass sich das Kundenverhalten über die Jahre, von Generation zu Generation, immer wieder verändert. Und wir stellen in der Tat fest, dass gerade jüngere Menschen vermehrt SMS, E-Mail schreiben, elektronische Dienste in Anspruch nehmen. Das ist nicht immer Ersatz für einen geschriebenen Brief - oftmals ist es eben auch ein Ersatz für ein Telefongespräch oder zusätzliche Kommunikation, die ganz neu entsteht. Aber generell ist es so, dass die Mengen Stück für Stück sinken. Ungefähr 2 bis 3 Prozent pro Jahr. Und unsere Aufgabe ist es, darauf eine Antwort zu finden,”
beschreibt Briefvorstand Jürgen Gerdes die Lage. Der Trend ist seit Jahren ungebrochen. 70 Millionen Briefe wandern täglich von Hand zu Hand. Doch zur gleichen Zeit werden 81 Millionen SMS per Handy verschickt. Eine bittere Entwicklung für die Post, die bislang mit dem Briefgeschäft viel Geld verdient hat und damit auch ihren Aufstieg zum weltweiten Logistikkonzern finanzieren konnte. Post-Chef Frank Appel:
„Also, der klassische Brief wird sicherlich rückläufig sein, aber er wird niemals sterben. Es wird immer ein Niveau geben, wo der klassische Brief einfach unschlagbar ist in seinen Eigenschaften gegenüber einem anderen Medium. Das wird auch in Zukunft so sein. Die Herausforderung und die Unbekannte dabei ist: wir wissen nicht, ob das bei 50 Prozent, bei 70 oder bei 80 Prozent vom heutigen Volumen sein wird. Das ist die Herausforderung.”
Der Brief ist natürlich viel älter als die Institution Post. Die Babylonier ritzten ihre Nachrichten auf Tontafeln, und die Ägypter nutzten den sogenannten Papyri für ihre Mitteilungen, vor gut 4700 Jahren. Die Eigenschaft des Briefes hat sich über die Jahrhunderte allerdings kaum geändert, meint Veit Didczuneit, zuständig für den Bereich Sammlungen beim Rundgang durch das Museum für Kommunikation in Berlin:
„Der Brief ist ein Nachrichtenmittel, ein Kommunikationsmedium, und man wollte Inhalte speichern und sie anderen zukommen lassen. Briefe haben durch die Geschichte hinweg 2 Komponenten. Den Inhaltsaspekt, dass man etwas mitzuteilen hat, beziehungsweise auch den Beziehungsaspekt, dass man, wie bei den Feldpostbriefen sagen wollte, ich bin noch am Leben, ich bin noch da - denkt an mich, oder ich denke an Euch.”
Doch bereits in der Antike entwickelte sich der Brief zu einer literarischen Kunstform. Julius Cäsar, Seneca oder auch Cicero machten den Anfang. Auch später nutzen viele andere Prominente den Brief zum Gedankenaustausch. Etwa Friedrich Schiller und Wolfgang Goethe. In einem Geburtstagsbrief schreibt Schiller am 23. August 1794 an seinen Freund:
„Lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang Ihres Geistes zugesehen und den Weg, den Sie sich vorgezeichnet haben, mit immer erneuerter Bewunderung bemerkt. Sie suchen das Notwendige der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das Einzelne Licht zu bekommen. Von der einfachen Organisation steigen Sie Schritt vor Schritt zu den mehr verwickelten hinauf um endlich die verwickelste von allen, den Menschen genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen. Eine große und wahrhaft heldenmäßige Idee, die zur Genüge zeigt, wie sehr Ihr Geist das reiche Ganze seiner Vorstellung in einer schönen Einheit zusammenhält.”
Niederlassung Brief, Hamburg Zentrum. Eine der größten in Deutschland. Zuständig für fast 1 Million Haushalte, 1.472 Briefkästen, 760 Mitarbeiter, 3,3 Millionen Sendungen pro Tag zu normalen Zeiten. Jetzt kurz vor Weihnachten herrscht auch hier Ausnahmezustand. Die Sortiererin am Band hat jede Menge zu tun:
„Also, einmal hier trennen, dann da an der Maschine, an der MA-Maschine. Und eben halt drüben zum Rollstempeln. Und Hammer-Stempel haben wir auch zum Beispiel, was noch mit der Hand gestempelt werden muss. Das sind dicke, kurze, wo was drin ist, was nicht durch die Maschine geht. Hier sortieren wir halt die Großbriefe, Kurzbriefe. Und eben die roten Tüten, das ist die Geschäftspost - die wird noch extra bearbeitet. Schnell müssen wir immer sein, überall.”
Der Druck auf die Mitarbeiter ist in den letzten Jahren ständig gewachsen. Kosten sparen heißt auch hier die Devise. Das schwindende Briefgeschäft soll so wirtschaftlich wie möglich organisiert werden. Und so sind es die Maschinen, die im Briefzentrum den Takt vorgeben. Und die nächste Generation steht schon bereit, freut sich der Vertreter der lokalen Geschäftsleitung:
„Wir kriegen auch im übernächsten Jahr neue Großsortieranlagen, so heißen die Maschinen, und die übernehmen dann auch weitgehend das Stempeln. Die Mitarbeiter? Ja, also entlassen worden ist noch keiner. Das wird man sicherlich sozial abfangen.”
Doch auch bei den Briefträgern hat sich inzwischen viel geändert. Zustellbezirke wurden zu größeren Einheiten zusammengelegt, und längst berechnet der Computer die günstigste Route - nach einer komplizierten Formel, zu der nicht zuletzt Wegezeiten, Verkehrsmittel und Lage gehören. Viele Boten klagen über den gestiegenen Arbeitsdruck, das weiß auch die stellvertretende verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis. Aber:
„Also ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Zustellung, die Stammbezirke haben, das heißt, die feste Reviere haben und tagtäglich die gleichen Strecken ablaufen und Briefsendungen zustellen - dass die noch gute Kontakte haben. Und für die Kundinnen und Kunden ist es auch wichtig, dass immer der gleiche Mensch kommt, der ihnen ihre Briefsendung zustellt. Das ist nicht überall möglich, aber ich glaube: die Post ist sozusagen noch immer das Gesicht zum Kunden über den Zusteller oder die Zustellerin.”
Und doch wird es auch für die rund 80.000 Briefzusteller der Post keine Atempause geben. Die Kosten müssen weiter runter, betont Konzernchef Appel:
„Wir haben in den letzten Jahren die Prozesse bei den Zulieferern weiter optimiert. Ja, da sind nicht mehr beliebig Produktivitätsreserven zu holen. In der gegebenen Arbeitszeit. Deswegen habe ich ja im Sommer gesagt: Natürlich können wir in der gegebenen Arbeitszeit nicht mehr beliebige Optimierungen machen, sondern wir müssen überlegen, die Arbeitszeit zu verlängern. Das haben wir jetzt im ersten Schritt nicht getan.”
Briefe sind weitaus mehr als Kommunikationsmittel. Briefe erzählen Geschichten und Schicksale - manchmal reicht dazu der Blick auf den Umschlag, sagt Veit Didczuneit vor einer kleinen Vitrine im Berliner Museum für Kommunikation:
„Hier in diesem Bereich sehen wir einen kunterbunten Brief. Man sieht also die Anschrift, man sieht viele Stempel. Man sieht Namen von europäischen Städten. Aber immer wieder auch durchgestrichen. Man könnte meinen, es ist Ausdruck einer Reiselust einer adligen Dame. Aber wenn man genau hinschaut, dann stellt man fest, dass diese Frau von der Asseburg 1887 höchstwahrscheinlich geschieden wurde - höchstwahrscheinlich aufgrund eines Ehebruchs, und Effi Briest lässt natürlich grüßen. Und in gewisser Weise deuten wir diesen Brief als Flucht vor der gesellschaftlichen Ächtung, die diesen Frauen widerfuhr, wenn sie Ehebruch begangen haben.”
Daneben ganz andere Emotionen. Briefe, die von Erfolg, Glück und vor allem von der leidenschaftlichen Liebe erzählen:
„Gustav Mahler an Alma Schindler. Berlin 12. Dezember 1901. Mein teueres liebes Mädchen. In einer schrecklichen Hetze zwischen Ankunft und erster Probe schnell innige Grüße und ein Schrei des Herzens nach Dir. Ich kann von jetzt ab nur im Hinblick auf Dich leben, atmen, sein. Ich dirigiere in Berlin selbst mein Werk. Oh, könntest Du dabei sein. Aber, so nötig es anderen ist, aus meinem Schaffen den Schlüssel zu meinem Sein zu gewinnen - Du, meine Alma, wirst von mir ausgehend, aus der allumfassenden Gegenwart heraus liebenshellsichtig alles erfahren - Du, ich, ich, Du, sein. Wenn die Töne, die Schallwellen soviel Kraft hätten als mein Liebesstreben nach Dir - so müsstest Du es den ganzen Vormittag klingen hören. Dir, für Dich soll es sein - alles was in mir lebt. Meine geliebte Alma. Dein Gustav.”
Bei der Post geht die fieberhafte Suche nach Ausweichstrategien weiter, um den schleichenden Niedergang des Briefes aufzufangen. Dabei musste der Branchenriese bereits teures Lehrgeld bezahlen. Die Expansion ins Ausland in andere Geschäftsfelder, vor allem vom früheren Konzernchef Klaus Zumwinkel vorangetrieben, hat sich bislang kaum ausgezahlt. Im Gegenteil: der Ausflug in das Expressgeschäft in den USA endete in einem Milliardendesaster. Frank Appel zeigt sich - zumindest nach außen - unbeeindruckt:
„Deswegen kann man nicht sagen: die Strategie ist gescheitert. Wir haben einfach das Problem, dass wir auf der einen Seite eine strukturelle Herausforderung im Brief haben durch das Internet. Weil die Menschen heute kaum noch Briefe schreiben. Wir haben bei der DHL, wenn der weltweite Handel einfach zusammenbricht, natürlich auch Auswirkungen. Ich glaube, dass wir nach der Krise die Schönheit dieser Strategie, nämlich ein globales Unternehmen in der Logistik zu schaffen, sehr wohl sehen werden. Wir haben enorme Wachstumschancen, wenn sich die Weltwirtschaft wieder erholen wird, und dann wird das deutlich in unseren Zahlen.”
Solange aber muss der Branchenriese weiter an mehreren Fronten kämpfen. 2011 werden die letzten eigenen Postfilialen geschlossen, dann werden die Kunden ihre Päckchen und Briefe nur noch beim Einzelhändler aufgeben. Auch andere Stellschrauben würde der Postchef gerne neu justieren, doch oftmals sind ihm die Hände gebunden. Das Porto etwa muss sich die Post von der Regulierungsbehörde genehmigen lassen. Und an wie vielen Tagen in der Woche zugestellt wird, regelt wiederum die sogenannte Universaldienstleistungsverordnung - das Grundgesetz der postalischen Versorgung. Gerne würde die Post die wöchentliche Zustellung von 6 auf 5 Tage verkürzen:
„Allerdings waren bisherige Versuche sehr negativ, sind negativ aufgenommen worden durch die Kunden. Und Dinge, die geplant waren, werden bereits wieder rückgängig gemacht. Ich glaube, dass die Post weiter suchen wird. Wir sind allerdings der Auffassung, dass die regelmäßige Zustellung der Vorteil ist, den die Post gegenüber allen anderen Unternehmen hat,”
stellt die stellvertretende verdi-Chefin Andrea Kocsis gelassen fest. Aber die Konzernspitze wird nicht locker lassen, auch nicht gegenüber den Mitarbeitern. Bis Ende 2011 gilt bei der Post eine Beschäftigungssicherungsklausel, dann dürfte erneut über längere Arbeitszeiten verhandelt werden. Und wenn das Briefaufkommen weiter schrumpft, wird es auch bei den Briefträgern Konsequenzen geben, kündigt Brief-Vorstand Gerdes an:
„Wir haben unterschiedlich alte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Einige gehen in Rente. Wenn das Volumen mal sinkt, dann werden wir halt mehr in Rente gehen lassen als wir neu aufbauen, neu einstellen. Ja, und so kann man das dann über den Zeitfaktor dann sauber managen.”
Lange Zeit war der Brief ein Privileg für Amtspersonen und reiche Kaufleute - der Transport kostete einfach zu viel Geld. Erst ab dem 18. Jahrhundert erreichte der Briefverkehr weitere Kreise der Oberschicht. Dann aber ging es Schlag auf Schlag. 1824 wurde der Briefkasten erfunden, 1840 in England die Briefmarke. Übrigens eine reine Rationalisierungsmaßnahme, um den ständigen Streit über die Transportkosten zu beenden. Der Brief, so Veit Didczuneit, wurde dann zum Massenkommunikationsmittel:
„Die großen Briefschreibaktionen der Weltgeschichte haben immer stattgefunden, wenn es den Zwang zum Brief gab. Gerade in Kriegen oder wenn es Teilungen gab, wie bei der innerdeutschen Teilung, dass es keine andere Möglichkeit gab sich auszutauschen. Wenn man den Zweiten Weltkrieg nimmt, dann haben wir in Deutschland ein Briefaufkommen von 1939 bis 1945 von 30 bis 40 Milliarden Feldpostsendungen.”
Schon im Ersten Weltkrieg nutzten die Soldaten den Brief als den einzigen Weg, Kontakt in die Heimat zu halten. Viele erschütternde Dokumente sind darunter, so auch der kritische Brief von Joachim Klinkhammer über die deutsche Kriegspropaganda. Der aus der Eifel stammende Soldat schrieb im Herbst 1915:
„Da wird nun die Stadt beflaggt. Alles brüllt Hurra, wenn ein Sieg errungen ist. Aber was damit verbunden ist, bleibt außer acht. Dass hunderte Leichen herumliegen, in den Drahthindernissen hängen - überhaupt wie ein Angriff zugeht, daran wird nicht gedacht. Und wer fällt, der stirbt den Heldentod. Auch ein schönes Wort, das hier keinen Anklang mehr findet. Das war einmal.”
Für die Post beginnt eine ungewisse Zukunft. Große Hoffnung setzt die Konzernspitze deshalb in den elektronischen Brief. Der soll den Abwanderungstrend ins Internet aufgreifen und daraus ein Geschäft machen - der für das 1. Halbjahr 2010 anvisierte Online-Brief wird kostenpflichtig sein. Es ist die neue Postwelt von morgen.
„Wir haben ein fantastisches Ausgangsprodukt. Der Brief ist jetzt über 500 Jahre alt. Der ist deshalb über 500 Jahre alt, weil alle wissen: er kommt immer an, niemand guckt rein - er ist also völlig geschützt - jeder weiß, dass der Absender und der Empfänger bekannt sind. Das haben die modernen E-Mail-Produkte erst einmal nicht. Und wir glauben, dass wir die 4 Kerneigenschaften - Absender bekannt, Empfänger bekannt, das Ding kommt sicher an und keiner schaut rein - dass wir das in die elektronische Welt übertragen können.”
Doch werden die Kunden das neue Produkt angesichts der vielen Datenschutzskandale überhaupt annehmen? Und sind sie bereit, für den elektronischen Brief zu bezahlen? Auch Brief-Vorstand Gerdes kann darauf keine Antworten geben:
„Wir erleben hier eine wahre Schreibfreude. Also die Kinder wie die Erwachsenen. Die schreiben lange, ausführlich. Alles schön geschmückt. Und auch die Teenies schreiben allein um des Schreibens willen.”
In Engelskirchen ist in diesen Tagen von den Nöten der Post nichts zu spüren. Im Weihnachtspostamt, sagt Birgit Müller, türmen sich wie jedes Jahr die Wunschbriefe an das Christkind.
„Wir haben hier also einen Brief von einer Laura-Jane: ‚Liebes Christkind, ich habe in diesem Jahr viel gelogen. Das soll im nächsten Jahr besser werden. Mit freundlichem Gruß, Deine Laura.’ Dann habe ich hier einen Brief von einem Benjamin: ‚Ich wünsche mir, dass es keinen Krieg gibt. Ich wünsche mir, dass es etwas zu essen gibt. Und ich wünsche mir ein Nintendo DS.’ Das war der Benjamin. Und jetzt schreibt ein Julian: ‚Liebes Christkind, ich wünsche mir von Dir, dass sich die Schweinegrippe nicht mehr so ausbreitet. Und dass die Wale nicht mehr so oft gejagt werden. Und dass Papa nicht in den Einsatz muss. Dass die Natur nicht mehr so leiden muss. Eine Einzelreitstunde. Dass meine ganze Familie gesund bleibt. Ich würde mich freuen, wenn ich eine Uniform kriege. Liebe Grüße, Dein Julian’.”
Zumindest an Weihnachten lebt er noch einmal auf - der vom Aussterben bedrohte, handgeschriebene Brief.
Der schleichende Tod des Briefes
Skript und Audio-Datei (MP3)
Audio-Datei - 2,9 MB - (3.05 min)
Adressenhandel und unerwünschte Werbung: Robinson-Liste
September 2012
Wieso werde ich überhaupt angeschrieben?
Für die (Werbe)Wirtschaft werden sogenannte qualifizierte Adressen immer wichtiger. Dabei handelt es sich nicht nur um die reine Adresse, sondern um ein „Paket”, in dem auch zusätzliche Informationen wie z.B. das Alter, besondere Interessen (Hobbies, Autos, Restaurants etc.), Familienstand (verheiratet, 2 Kinder unter 2 Jahren, Single,...), Gehaltsklasse und weitere Informationen enthalten sind. Es ist nämlich wesentlich erfolgversprechender, die Werbung für den teuren, 2-sitzigen Luxussportwagen an Singles über 30 Jahre mit mindestens 80.000 Euro Jahresverdienst zu schicken als an die 4-köpfige junge Familie mit einem Jahreseinkommen von 40.000 Euro.
Da durch gezielte Bewerbung der (aus Sicht des Anbieters) am meisten geeigneten Bevölkerungsgruppe viel Geld für „sinnlose” Werbung gespart werden kann, hat sich ein regelrechter Markt rund um qualifizierte Adressen gebildet. Sogenannte Adressverlage tun nichts anderes, als Adressen und möglichst viele öffentlich zugängliche Zusatzinformationen zu sammeln, um ihren Kunden die für Werbebriefe geeigneten Adressen verkaufen zu können. Je treffender und spezieller die Qualifizierungen sind, desto mehr kostet eine Adresse. So ist eine Liste der Bewohner eines bestimmten Stadtteils wesentlich billiger pro Adresse zu haben als eine Liste Alleinerziehender mit mindestens 2 Kinder aus dem gleichen Stadtteil.
Woher kommen die Informationen?
Die Informationen kommen aus den unterschiedlichsten, öffentlich zugänglichen Quellen und häufig auch vom Betroffenen selber. Zwar kommt es auch vor, dass Daten unrechtmäßig erhoben, verarbeitet und genutzt werden, aber sehr häufig gibt man im Laufe der Zeit an den verschiedensten Stellen Informationen preis, ohne sich über die weitere Verwendung Gedanken zu machen, oder man unterschreibt Datenschutz-Klauseln, die den Namen nicht verdient haben. Unter öffentlich zugänglichen Quellen fallen beispielsweise Telefon-, Telefax-, und Branchenbücher, Internet-Seiten, Handelsregister, Teile der Melderegister, Schuldnerverzeichnisse, öffentliche Bekanntmachungen aller Art und viele mehr.
Die Bekanntgabe durch eigenes Zutun geschieht beispielsweise durch Visitenkarten (Messebesuch o.ä.), Teilnahme an Preisausschreiben, Aufgabe von Zeitungsanzeigen, Nachsendeaufträgen, Teilnahme an Kundenbindungsprogrammen (wie z.B. der Payback-Karte), Abschluss von Telefonverträgen, Bestellung über Versandhandel, Buchung einer Reise u.s.w. Oftmals wird dabei versäumt, die mit der jeweiligen Vertragsgestaltung verbundenen Datenschutzklauseln genau zu lesen und unerwünschte Zwecke zu streichen oder den Zweck von vorneherein zu begrenzen.
Was kann ich tun?
Die Adresse und sonstige Informationen sollten nur zweckgebunden angegeben werden. Wenn Sie z.B. eine Reise buchen, sollten Sie schriftlich unter den Vertrag setzen „Keine Adressweitergabe an Dritte” oder zumindest „Keine Verwendung dieser Daten für Werbezwecke oder Zwecke der Markt- und Meinungsforschung”.
Widersprechen Sie der Weitergabe Ihrer Daten zu Werbezwecken auch gegenüber der Meldebehörde in Bezug auf die Weitergabe von Wählerlisten an die Parteien vor Wahlen oder die Weitergabe von Meldeangaben an Adressbuchverlage.
Verändern Sie Ihre Adresse bei verschiedenen Gelegenheiten (Teilnehmerlisten von Tagungen, Warenbestellung, Reisebuchung o.ä.) geringfügig, z.B. durch Einfügung eines Mittelnamens „Helga M. Mustermann”. Wenn Sie sich notieren, wo Sie die jeweils veränderte Adresse abgegeben haben, können Sie bei so mancher Werbung erkennen, wer Ihre Adresse weitergegeben hat.
Schicken Sie die Werbung mit dem Vermerk „Zurück an Absender” wieder zurück.
Nehmen Sie Ihr Recht auf Auskunft gemäß § 34 Bundesdatenschutzgesetz wahr und fordern Sie den Absender der Werbung auf, Ihnen Auskunft zu erteilen:
- über alle zu Ihrer Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf Herkunft und Empfänger beziehen
- über den Zweck der Speicherung und
- im Fall automatisierter Datenverarbeitung über Personen und Stellen, an die Ihre Daten regelmäßig übermittelt werden.
Herkunft und Empfänger müssen von Adressunternehmen jedoch nur dann genannt werden, wenn Sie begründete Zweifel an der Richtigkeit der Daten geltend machen.
Sie können beim speichernden Unternehmen (also bei jedem, der Sie mit Werbebriefen angeschrieben hat, aber auch bei Adresshändlern, von denen Sie wissen, dass sie Ihre Adresse speichern) der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder Markt- und Meinungsforschung gemäß § 28 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz jederzeit widersprechen - also bereits bei Abgabe der Adresse oder Abschluss eines Vertrages, aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt. Die weitere Verwendung Ihrer Daten durch die speichernde Stelle wäre dann strafbar.
Robinsonliste
Wollen Sie Ihren Widerspruch im kommerziellen Bereich möglichst effizient gestalten und breit streuen, so bietet sich die Aufnahme in die sogenannte Robinson-Liste an. Es handelt sich hierbei um eine von der deutschen Werbewirtschaft geführte Liste „werbeunwilliger BürgerInnen”, die von den Mitgliedern des Deutschen Direktmarketing-Verbands beachtet wird, d.h. von diesen wird Ihre Adresse gesperrt. Allerdings erzielt man hierdurch keinen vollständigen Erfolg, denn nur ein Teil der Adresshändler ist dem Verband angeschlossen und die Aktualisierung der Liste erfolgt nicht eben häufig. Zwischen Eintragung und erstem Erfolg kann daher einige Zeit vergehen, denn erst bei der jeweils nächsten Aktualisierung von Adressbeständen wird Ihre Anschrift ausgefiltert. Die Eintragung muss alle 5 Jahre erneut beantragt werden.
Beantragen Sie die Aufnahme in die Robinson-Liste unter:
Deutscher Direktmarketing-Verband e.V.
Robinson-Liste
Postfach 1401
71243 Ditzingen
Haben Sie das Gefühl, dass in einem Sie betreffenden Fall ein Datenschutzverstoß vorliegt, so wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde. Die Zuständigkeit richtet sich dabei nach dem Bundesland, in dem das beschuldigte Unternehmen seinen Sitz hat. Die Anschriften der Aufsichtsbehörden finden Sie im Internet unter www.datenschutz.de (Stichwort: Institutionen) oder Sie können sie telefonisch bei der Geschäftsstelle der Deutschen Vereinigung für Datenschutz e.V., Bonner Talweg 33-35, 53113 Bonn, Tel. 0228/22 24 98 erfragen.
Der Bundesbeauftragte für die Datensicherheit und die Informationsfreiheit (BfDI) hat zum Thema „Adresshandel und unerwünschte Werbung” eine Broschüre herausgegeben.
Quelle: Deutsche Vereinigung für Datenschutz e.V.
Individualisierter Verbraucherschutz mit der DDV-Robinsonliste
22.07.2008
Verbraucher wollen selbst wählen, welche Werbung sie erhalten möchten
Immer mehr Verbraucher entschließen sich, die Robinsonliste des Deutschen Dialogmarketing Verbandes DDV zu nutzen, um selbst entscheiden zu können, aus welchen Bereichen sie Werbung erhalten möchten und aus welchen nicht. Ein Eintrag in die Robinsonliste ermöglicht es, nur noch erwünschte personalisierte Werbesendungen zugesandt zu bekommen und sich vor unaufgefordert zugeschickten zu schützen. Bis Ende Juni 2008 haben sich 18.000 Bürger neu eintragen lassen, damit sind es nun insgesamt 675.440 Einträge. Erfreuliche Entwicklung: Gestiegen ist der Anteil derjenigen, die sich für die „Alternative B” entschieden haben, einem Ausschlussverfahren, bei dem man ankreuzen kann, aus welchen Branchen man keine Werbung mehr erhalten möchte. Zurzeit machen bereits 11 Prozent der Neuzugänge von dieser Möglichkeit Gebrauch, sich auf Werbung zu konzentrieren, die erwünscht ist. Der DDV fühlt sich damit einmal mehr bestätigt, dass die im Jahr 2005 eingeführte Alternative B für die Bürger einen hohen Nutzwert hat.
Die Robinsonliste gibt es bereits seit 1971. Sie bezieht sich auf unaufgefordert zugesandte personalisierte Werbebriefe, nicht auf Werbung aus Unternehmen, mit denen der Verbraucher bereits in Kontakt getreten ist. Unternehmen gleichen die Robinsonliste mit ihren Werbeadressen ab und verzichten auf das Versenden von personalisierter Werbepost an die dort enthaltenen Adressen. Bei über 90 Prozent des Gesamtvolumens an Werbebriefen erfolgt bereits ein Einsatz der Robinsonliste auf freiwilliger Basis. Eine Robinsonliste für Telefonwerbung bietet der DDV nicht an, da es diese nach der Rechtsauffassung des Verbandes nicht geben kann. Die Gesetzgebung sieht vor, dass für Anrufe bei Privatpersonen - anders als bei der Zusendung von Werbebriefen - stets die vorherige Zustimmung zu einem Anruf vorliegen muss. Ein Abgleich mit „gesperrten Adressen” oder einer Negativliste ist von daher systemwidrig. Verbraucherinnen und Verbraucher können sich über die Robinsonliste auf der Website www.ddv-robinsonliste.de informieren.
Quelle: Deutscher Direktmarketing-Verband
Werbung und Adresshandel
September 2012
Die werbliche Ansprache bestehender oder potenzieller Kunden ist für die Unternehmen von herausragender Bedeutung, um den Absatz zu steigern und sich neue Zielgruppen zu erschließen. Die Sammlung und Auswertung ihrer personenbezogenen Daten bildet die Grundlage einer möglichst interessenbezogenen Werbung durch die Unternehmen. Werbung und Adresshandel sind dabei eng miteinander verbunden, da die werbenden Unternehmen häufig nicht nur ihre eigenen Datenbestände nutzen, sondern auch auf die Kenntnisse spezialisierter Dienstleister zurückgreifen.
Für die Kunden kann die Information über neue Produkte und Rabattaktionen willkommen sein - oder einfach nur stören. Die folgenden Informationen sollen Ihnen einen Überblick über die Bestimmungen und Rechte im Zusammenhang mit dem Datenhandel und der Werbung geben. Sie sind der gemeinsam vom BfDI und mehreren Landesdatenschutzbeauftragten herausgegebenen Broschüre „Adresshandel und unerwünschte Werbung” entnommen, welche zudem viele weitere praktische Tipps enthält.
Wie kommen die werbenden Unternehmen an meine Adresse?
Einige Unternehmen führen gezielt Preisausschreiben, Verlosungen oder Informationsveranstaltungen durch, um an Anschriften und werberelevante Informationen zu kommen. Auch Kundenbindungsprogramme und Rabattsysteme dienen häufig diesem Zweck. Viele Werbende greifen darüber hinaus auf Adressbestände anderer Unternehmen und Organisationen zurück.
Dabei kann es durchaus sein, dass das werbende Unternehmen selbst weder Ihre Adresse noch sonstige Informationen über Sie speichert. Denn oft führen Unternehmen die Werbung nicht selbst durch, sondern beauftragen ein anderes Unternehmen damit, für sie zu werben. Diesem Dienstleister wird es überlassen, die konkreten Adressen aus eigenen Beständen auszuwählen oder von einem Adressmakler oder -händler zu mieten.
Nicht nur Adresshandelsunternehmen vermieten oder verkaufen auf spezielle Zielgruppen zugeschnittene Datenbestände. Auch andere Unternehmen und sonstige Organisationen können ihre Kunden- oder Mitgliederadressen vermieten oder verkaufen. Das gilt beispielsweise für Versandhandelsunternehmen. Diese können aufgrund langfristiger Geschäftsbeziehungen mit ihren Kundinnen und Kunden zahlreiche Adressen anbieten, wenn sie dabei bestimmte Regeln einhalten, die das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) vorschreibt.
Sind Weitergabe und Nutzung meiner Adresse für Werbezwecke zulässig?
Grundsätzlich dürfen Sie ohne Ihre Einwilligung nicht persönlich mit Werbung angesprochen werden. Es gibt aber leider zahlreiche Ausnahmen von diesem Grundsatz. Bei bestimmten personenbezogenen Daten, den sogenannten Listendaten, ist es oft auch ohne Ihre Einwilligung möglich, dass diese Daten für Zwecke der Werbung genutzt und weitergegeben werden, solange Sie nicht widersprechen oder die verantwortliche Stelle nicht aus sonstigen Gründen annehmen muss, dass Ihre schutzwürdigen Interessen der Werbenutzung entgegenstehen.
Zu den Listendaten gehören nicht nur Name und Anschrift, Titel und akademischer Grad, sondern auch Geburtsjahr, Berufs-, Branchen oder Geschäftsbezeichnung sowie ein Merkmal, das die einzelne Person als einer Gruppe angehörend kennzeichnet, beispielsweise Teetrinker(in), Golfspieler(in) oder Hundebesitzer(in).
Diese Listendaten können auch ohne Ihre Einwilligung für Werbezwecke verwendet werden, wenn das werbende Unternehmen die Daten von Ihnen selbst erhalten oder aus öffentlichen Branchen-, Adress- oder Telefonverzeichnissen entnommen hat. Darüber hinaus können diese Daten für die Spendenwerbung für gemeinnützige Organisationen verarbeitet werden. Auch berufliche Werbung unter Ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Adresse ist ohne Weiteres erlaubt.
Eine Weitergabe von Listendaten für die Werbenutzung ist darüber hinaus möglich, wenn gesetzliche Kennzeichnungs- und Informationspflichten eingehalten werden, die für die Betroffenen den Weg ihrer Daten nachvollziehbar machen.
Außerdem können Unternehmen ihre eigenen Adressdateien nutzen, um für andere Unternehmen Werbung zu machen. Es muss lediglich aus der Werbung erkennbar sein, bei welcher Stelle die Adressen gespeichert sind und welche Stelle die Werbung betreibt.
Weitere personenbezogene Daten - zum Beispiel zu Ihrem Kauf- und Zahlungsverhalten - dürfen immer nur dann für Werbezwecke weitergegeben oder genutzt werden, wenn Sie vorher eingewilligt haben. Eine wirksame Einwilligung setzt voraus, dass Sie über den Zweck der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung unterrichtet wurden. Außerdem müssen Sie darauf hingewiesen werden, dass die Einwilligung freiwillig ist und Sie sie jederzeit widerrufen können. Wenn Sie Ihre schriftliche Einwilligung gemeinsam mit anderen Erklärungen abgeben sollen, muss die Einwilligung optisch hervorgehoben werden.
Wie kann ich mich vor der Weitergabe meiner Adresse schützen?
Wenn Sie ausdrücklich um Ihre Einwilligung in die Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke gebeten werden, überlegen Sie gut, ob Sie Ihre Daten wirklich für diesen Zweck preisgeben wollen. Auch wenn Ihnen Rabatte oder Bonuspunkte angeboten werden, lohnt sich das oft nicht. Die späteren Belästigungen können ärgerlich sein, und manche Sonderangebote oder Rabatte, mit denen Sie gelockt werden sollen, entpuppen sich als Mogelpackung. Der Abschluss eines Vertrages darf übrigens nicht von einer Einwilligung abhängig gemacht werden, soweit ein anderer Zugang zu gleichwertigen vertraglichen Leistungen ohne die Einwilligung nicht oder nicht in zumutbarer Weise möglich ist.
Auch gesetzlich erlaubter Adresshandel und Werbung werden unzulässig, sobald Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke erheben. Dazu müssen Sie gegenüber der verantwortlichen Stelle (zum Beispiel der werbenden Firma oder dem Adresslieferanten) erklären, dass Ihre Daten für Zwecke der Werbung weder genutzt noch weitergegeben werden sollen. Sie können gleichzeitig auch der Verarbeitung Ihrer Daten für die Markt- und Meinungsforschung widersprechen, wenn Sie das wünschen. Ihr Widerspruch könnte beispielsweise wie folgt lauten:
„Ich widerspreche der Nutzung oder Übermittlung meiner Daten für Werbezwecke und für die Markt- oder Meinungsforschung.”
Sie können jederzeit widersprechen, also auch bereits dann, wenn Sie Ihre persönlichen Daten erstmals gegenüber einem Geschäfts- oder Vertragspartner angeben. Damit können Sie erreichen, dass es gar nicht erst zur Zusendung von Werbebriefen kommt.
Auf Ihr Widerspruchsrecht müssen Sie übrigens bei der Werbeansprache hingewiesen werden und erfahren, wie und wo Sie Widerspruch einlegen können.
Wie erfahre ich, wer mit meiner Anschrift handelt oder wirbt?
Hier helfen Ihnen einige Informationspflichten und Auskunftsrechte, die im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt sind:
Haben Unternehmen oder sonstige Organisationen vor, die von Ihnen erhaltenen Daten nicht nur für den vereinbarten Zweck, sondern beispielsweise auch für Werbezwecke zu verarbeiten oder zu nutzen, so müssen sie Sie bereits bei Erhebung Ihrer Daten über diese Zwecke und die möglichen Arten von Empfängern der Daten unterrichten (§ 4 Absatz 3 BDSG).
Wenn Unternehmen gezielt durch Verlosungen, Preisausschreiben, Haushaltsbefragungen oder bei Informationsveranstaltungen Daten erheben, um sie anschließend für Werbezwecke zu verwenden oder zu veräußern, müssen Sie von vornherein um Ihre Einwilligung in diese Nutzung für Werbezwecke gebeten werden und über die Tragweite dieser Einwilligungserklärung informiert werden. Wenn Sie die Einwilligung mündlich erteilen, ist Ihnen der Inhalt Ihrer Einwilligung später schriftlich zu bestätigen. Elektronische Einwilligungen müssen protokolliert werden, und Sie müssen jederzeit die Möglichkeit haben, den Inhalt Ihrer Einwilligung noch einmal abzurufen (§ 4a, § 28 Absatz 3a BDSG).
Mit dem Werbeschreiben selbst müssen Sie über die verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer Adressdaten (zum Beispiel das werbende Unternehmen) sowie über Ihr Widerspruchsrecht informiert werden (§ 28 Absatz 4 Satz 2 BDSG).
Wenn das werbende Unternehmen keine eigenen Datenbestände nutzt, sondern etwa ein Adresshandelsunternehmen mit der Werbung beauftragt, muss sich aus dem Werbeschreiben eindeutig ergeben, welche Stelle für die Datennutzung verantwortlich ist (§ 28 Absatz 4 Satz 2 BDSG).
Wurden die Daten, die für Werbezwecke genutzt werden, ursprünglich durch ein anderes Unternehmen erhoben, so muss sich aus dem Werbeschreiben auch ergeben, welches Unternehmen Ihre Daten erstmalig erhoben hat (§ 28 Absatz 3 Satz 4 BDSG).
Ihr Auskunftsrecht: Sie können gemäß § 34 Absatz 1 BDSG von dem werbenden Unternehmen oder dem Adresslieferanten grundsätzlich Auskunft verlangen über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten, ihre Herkunft, den Zweck der Speicherung und die Empfänger, an die Daten weitergegeben werden. Soweit konkrete Empfänger noch nicht genannt werden können, reicht es, Kategorien von möglichen Empfängern der Daten wie beispielsweise Autohändler oder Versandhandelshäuser anzugeben. Dieses Auskunftsrecht wird für nach dem 1. April 2010 erhobene oder gespeicherte Daten durch eine gesetzliche Pflicht zur Dokumentation der Herkunft für übermittelte Adressdaten unterstützt (§ 34 Absatz 1a BDSG).
Nur wenn ein gewerbsmäßiger Adresshändler ein überwiegendes Interesse an der Wahrung eines Geschäftsgeheimnisses darlegt, kann er die Auskunft zu Herkunft und Empfänger der Daten verweigern.
Wie kann ich mich vor unerwünschter Werbung schützen?
In jedem Einzelfall Werbewiderspruch einzulegen, kann sehr aufwendig sein. Im Folgenden haben wir daher noch ein paar Empfehlungen, wie Sie die Werbeflut möglichst weitgehend von Briefkasten, Telefon, Faxgerät und PC fernhalten können:
Werbung per Post
Briefkastenaufkleber „Keine Werbung bitte”
Der Aufkleber schützt vor Werbematerial und sonstigen, nicht an Sie adressierten Postwurfsendungen. Die Verteilerinnen und Verteiler müssen sich an Ihren Wunsch halten. Tun sie es nicht, liegt ein Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vor. In diesem Fall können Sie selbst oder ein Verbraucherverband gegen das Verteiler- bzw Werbeunternehmen zivilrechtlich vorgehen.
Keinen Schutz bietet der Aufkleber vor Werbezuschriften, die persönlich an Sie adressiert sind. Auch bei Werbung, die zwar nicht namentlich adressiert ist, aber an die Bewohner eines konkreten Hauses gesendet wird, hilft der Aufkleber leider nicht. Denn die Post kann und darf in diesen Fällen nicht feststellen, ob es sich um unerwünschte Werbung oder aber um eine von Ihnen veranlasste Zusendung oder etwa um ein Schreiben Ihrer Hausverwaltung handelt.
Robinson-Liste
Für adressierte Werbebriefe bietet der private Deutsche Dialog-Marketing-Verband (DDV) Verbraucherinnen und Verbrauchern an, sich in die sogenannte Robinson-Liste eintragen zu lassen. Die dem DDV angeschlossenen Unternehmen erhalten dann die Nachricht, dass Sie keine Werbung wünschen. Auf diesem Weg erreichen Sie eine deutliche Reduktion der Werbeflut. Eine Eintragung gilt für 5 Jahre. Das Formular für die Aufnahme in die Liste erhalten Sie bei:
DDV, Robinson-Liste, Postfach 1401, 71243 Ditzingen,
Telefon: 0 71 56 / 95 10 10,
oder unter www.ddv-robinsonliste.de.
Werbung per Telefon, Fax oder SMS
Sie können gegen Werbende, die Sie ohne Ihre Einwilligung per Telefon, Fax oder SMS mit Werbung ansprechen, in der Regel zivilrechtlich vorgehen. Sie können dazu Unterlassung der Werbung verlangen oder eine Stelle einschalten, die die werbende Stelle abmahnt. Unterstützung dafür erhalten Sie bei den Verbraucherschutzverbänden oder bei der Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Die Adressen finden Sie im Anhang der Broschüre. Die Verbraucherschutzorganisationen sind zur außergerichtlichen Rechtsberatung und -besorgung auf dem Gebiet des Verbraucherrechts berechtigt. Sinnvoll ist dieses Vorgehen jedoch nur dann, wenn die Werbung von einem in Deutschland ansässigen Anbieter stammt.
Auch hier besteht zwar die Möglichkeit einer Eintragung in Robinsonlisten oder vergleichbare Listen gegen Telefon-, Telefax- oder E-Mail-Werbung. Da Werbung auf diesem Weg im Gegensatz zur Briefwerbung generell nur mit Einwilligung erlaubt ist, haben solche Listen jedoch wenig Sinn. Manchmal werden sogar Gebühren für die Eintragung in die Listen verlangt. Das ist besonders unseriös. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Listen gegen die Telefon-, Telefax- oder E-Mail-Werbung missbräuchlich genutzt werden, um gerade den eingetragenen Personen Werbung zu senden. Auf einen Eintrag kann deshalb verzichtet werden.
Telefonwerbung
... ist ohne Ihr vorheriges Einverständnis unzulässig. Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, haben Sie 2 Möglichkeiten: Entweder Sie weisen die anrufende Person knapp auf die Rechtswidrigkeit des Anrufs hin und beenden das Gespräch. Oder Sie versuchen, das werbende Unternehmen zu identifizieren. Da eine Rufnummernunterdrückung für Werbeanrufe verboten ist, sollten Sie mindestens die Telefonnummer des werbenden Unternehmens festhalten können.
Die Bundesnetzagentur hält unter www.bundesnetzagentur.de ein Formular bereit, mit dem Sie Anzeige erstatten können, wenn Sie unerlaubte Telefonwerbung erhalten. Mit diesem Formular werden die Angaben erfragt, die die Bundesnetzagentur für ein Bußgeldverfahren wegen unerlaubter Telefonwerbung benötigt.
Fax- und SMS-Werbung
... ist ebenfalls ohne Ihr vorheriges Einverständnis unzulässig. In vielen Fällen ist es sehr schwierig, den entsprechenden Unterlassungsanspruch durchzusetzen. Denn die Absender der rechtswidrigen Werbefaxe oder SMS, die oft nicht identisch mit den Werbenden sind, lassen sich - wenn überhaupt - nur mit großem Aufwand ermitteln. Vielfach werden Fax oder Handy-Nummern nicht gezielt ausgewählt, sondern durch Computer erstellt. Wegen der einfachen und allseits bekannten Nummernstruktur bedarf es nur eines kleinen Programms, das automatisch Nummern erzeugt. An die künstlich erzeugten Verbindungsnummern werden dann Faxe oder Werbe-SMS versandt - in der Hoffnung, dass sich hinter möglichst vielen Nummern tatsächliche Anschlüsse verbergen. Auch für die Anzeige unzulässiger Fax und SMS-Werbung finden Sie unter www.bundesnetzagentur.de Formulare.
Werbung per E-Mail
Auch die Werbung per E-Mail ist meist nur dann erlaubt, wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben. Sie ist allerdings auch zulässig, wenn das absendende Unternehmen Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung von Ihnen erhalten hat. In diesem Fall darf das Unternehmen Ihre E-Mail-Adresse aber nur zur Direktwerbung für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwenden. Sie können sich auch gegen diese Werbung wehren, indem Sie der Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse für Werbezwecke widersprechen. Auf das Recht zum jederzeitigen Widerspruch muss das werbende Unternehmen Sie hinweisen. Unterlässt es dies, ist die Werbung unzulässig.
Quelle: Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
3D-Drucker drängen in den Markt
08.04.2013
- BITKOM-Umfrage zu 3D-Printing
- Herausforderungen für Wirtschaft und Politik
 3D-Drucker werden sich am Markt durchsetzen und einen enormen Einfluss auf große Teile der Wirtschaft haben. 81 Prozent aller ITK-Unternehmen rechnen damit, dass 3D-Drucker einzelne Branchen stark verändern. 3 Prozent meinen sogar, die Geräte würden die Wirtschaft insgesamt revolutionieren. Das ergab eine repräsentative Befragung im Auftrag des Hightech-Verbandes BITKOM. Nur 8 Prozent der befragten Unternehmen sind der Meinung, 3D-Drucker würden generell keine große Bedeutung entwickeln. Lediglich 6 Prozent glauben, die Geräte seien vor allem für Privatverbraucher interessant. „3D-Drucker haben das Potenzial, schon in wenigen Jahren viele Wirtschaftszweige nachhaltig und stark zu verändern”, sagte BITKOM-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder zum Start der Hannover Messe. Nicht nur Güter des täglichen Gebrauchs wie Geschirr und Designgegenstände, Spielzeug oder Materialien für Heimwerker kann man künftig mit 3D-Druckern zu Hause nach Bedarf herstellen. Langfristig ist denkbar, dass beispielsweise auch Ersatzteile fürs Autos oder gar Zahnfüllungen oder Prothesen vor Ort in Werkstätten oder Arztpraxen mit speziellen 3D-Druckern produziert werden.
3D-Drucker werden sich am Markt durchsetzen und einen enormen Einfluss auf große Teile der Wirtschaft haben. 81 Prozent aller ITK-Unternehmen rechnen damit, dass 3D-Drucker einzelne Branchen stark verändern. 3 Prozent meinen sogar, die Geräte würden die Wirtschaft insgesamt revolutionieren. Das ergab eine repräsentative Befragung im Auftrag des Hightech-Verbandes BITKOM. Nur 8 Prozent der befragten Unternehmen sind der Meinung, 3D-Drucker würden generell keine große Bedeutung entwickeln. Lediglich 6 Prozent glauben, die Geräte seien vor allem für Privatverbraucher interessant. „3D-Drucker haben das Potenzial, schon in wenigen Jahren viele Wirtschaftszweige nachhaltig und stark zu verändern”, sagte BITKOM-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder zum Start der Hannover Messe. Nicht nur Güter des täglichen Gebrauchs wie Geschirr und Designgegenstände, Spielzeug oder Materialien für Heimwerker kann man künftig mit 3D-Druckern zu Hause nach Bedarf herstellen. Langfristig ist denkbar, dass beispielsweise auch Ersatzteile fürs Autos oder gar Zahnfüllungen oder Prothesen vor Ort in Werkstätten oder Arztpraxen mit speziellen 3D-Druckern produziert werden.
3D-Drucker sind mittlerweile ab rund 2.000 Euro zu haben. Sie kehren die Formgebung von Gütern um. Normalerweise wird Material abgetragen: etwa ein Stück Metall oder Holz von Maschinen oder Menschen gefräst, geschliffen, gedreht, gedengelt oder gedrechselt. Experten sprechen von zerspanender Bearbeitung. Das Endprodukt entsteht also durch Trennung - ähnlich wie bei einem Bildhauer, der einen Marmorblock bearbeitet.
3D-Drucker hingegen arbeiten ähnlich wie Töpfer oder Maurer: Ein Produkt wird gefertigt, indem Material schichtweise aufgebaut wird - nur automatisch. Zunächst wird das Produkt in einem Datensatz als virtuelles 3D-Modell beschrieben. Beim Druck dieser Datei wird in der Regel ein Grundstoff (meist flüssiger Kunststoff, aber auch Keramik oder Metall) Schicht für Schicht per Spritzdüse auf einer Grundfläche aufgebracht, dann wird die Fläche millimeterweise abgesenkt und die neue Lage aufgebracht. So entsteht aus einer Computerdatei ein 3-dimensionales Produkt. Rohleder: „3D-Drucker stellen viele Branchen vor enorme Herausforderungen. Wertschöpfungsketten werden sich stark verändern und auch der Produkt- und Markenschutz muss ganz neu gedacht werden.”
Zur Methodik: Das Meinungsforschungsinstitut Aris hat im Februar im Auftrag des BITKOM 320 Unternehmen aus der ITK-Branche zu den Potenzialen von 3D-Druckern befragt. Die Umfrage ist repräsentativ für die Branche.
Frisch aus dem Drucker – Die 3D-Technologie könnte die Logistik verändern. Risiko oder Revolution?
Mai 2013
Zum Thema 3D-Druck veröffentlichte die Mitarbeiter-Zeitung Premium Post in ihrer Ausgabe 2/2013 folgenden Beitrag, der dank der freundlichen Zustimmung der Redaktion diese Chronik bereichert:
Schuhe, Ersatzteile für das Auto oder eine neue Küchenlampe schnell selbst ausdrucken? Was nach Zukunftsmusik klingt, ist in der Industrie längst Realität. Bereits seit den 1980er-Jahren können 3D-Drucker Objekte zum Anfassen herstellen. Heute ist ein Einsteigermodell schon ab 500 Euro zu haben. Weil die Geräte immer billiger werden, ist künftig wohl mit einem starken Wachstum auf dem Markt für 3D-Drucker zu rechnen.

Anfang Februar 2013 veranstaltete Solutions & Innovation (S&I) im Innovation Center *) der Deutschen Post DHL in Troisdorf eine Tagung zum Thema 3D-Druck. Wie sehen die Möglichkeiten dieser Technologie aus? Wo sind ihre Grenzen? Und was sind die Konsequenzen für die Logistikbranche? Diese und weitere Fragen wurden während des ersten „3D Printing Day” mit Experten und Interessierten aus dem Postkonzern, insbesondere Vertretern von DHL Supply Chain, diskutiert.
Neue Geschäftsmodelle: 2 Visionen
In einem Forschungsprojekt lotet das Team um Markus Kückelhaus mögliche Chancen und Risiken der 3D-Technologie für Deutsche Post DHL aus. Ausgangspunkt ist folgendes Szenario: Logistikketten verkürzen sich, da mithilfe von 3D-Druckern alle Teile da produziert werden können, wo sie gebraucht werden. Wenn Verpackung und Versand überflüssig werden, müssen neue Geschäftsmodelle her. Eine Zukunftsvision, die das S&I-Forschungsprojekt in Betracht zieht, ist das „digitale Lagerhaus”: DHL druckt Ersatzteile nach Bedarf und nahe beim Kunden. Eine andere Option für Privatkunden wäre der „3D-Druck-Shop”: Konsumenten könnten in einem DHL-Copyshop ihre persönlichen Konsumgüter ausdrucken lassen.
3D-Druckverfahren noch nicht ausgereift
Die möglichen Szenarien würden zum jetzigen Zeitpunkt allerdings an den Grenzen der Technologie und der Wirtschaftlichkeit scheitern: „Die bislang zur Verfügung stehenden 3D-Druckverfahren weisen gegenüber etablierten Fertigungsverfahren noch erhebliche Nachteile auf”, sagt Markus Kückelhaus. Zu gering ist die Spannbreite an nutzbaren Rohmaterialien, zu eingeschränkt der Anteil produzierbarer Güter mit hinreichender Qualität, zu lang die Produktionszeit im Vergleich zu industriellen Herstellungstechniken. Dennoch: Kückelhaus glaubt, dass der 3D-Druck Auswirkungen auf die Logistik haben wird, nur - „3D-Drucken beschränkt sich heute auf bestimmte Nischen und ausgewählte Produkte. Die Zeit ist einfach noch nicht reif für eine massenhafte Anwendung.”
Ende des Premium Post-Artikels.
Wie funktioniert ein 3D-Drucker?
Ein 3D-Drucker druckt keine Texte und Fotos. Er stellt mithilfe einer Konstruktionsdatei (CAD) 3-dimensionale Gegenstände her - Schrauben, Tassen, Gebrauchsgegenstände, in der Industrie z.B. Dieselmotoren oder Ersatzteile, in der Medizintechnik Ersatzhaut etwa bei Verbrennungen, künstliche Ohren oder Lungengewebe und Knochenimplantate. Der Drucker arbeitet mit unterschiedlichen Rohstoffen, u.a. Kunststoff. Er wird bei einer Temperatur von ca. 230 Grad geschmolzen, dann auf eine Acrylglasplatte aufgetragen. Schicht für Schicht spritzt die Druckerdüse den Kunststoff aufeinander. Nach einigen Stunden ist die selbst gedruckte Tasse fertig. Grundlage für den Ausdruck sind 3D-Modellzeichnungen. Im Internet sind solche Zeichnungen kostenlos im Angebot, so z.B. unter www.thingiverse.com oder http://www.nextdayreprap.co.uk/tag/next-day-3d-printers/ - von Tassen und Handyhüllen bis zu Modellen historischer Bauwerke.
3D-Druck vor Ort: Fab Labs
In einigen Städten gibt es schon sogenannte Fab Labs - 3D-Werkstätten, in denen der Kunde selbst mit 3D-Druckern arbeiten darf, so in Aachen, Berlin, Düsseldorf, Erlangen, Hamburg, Köln, München und Nürnberg.
Die Materialien
Viele 3D-Drucker, besonders Drucker für den Privatgebrauch, arbeiten mit Kunststoff. Allerdings gibt es auch Druckmaterial aus Maisstärke, Sand oder Metall. In der Wissenschaft arbeiten 3D-Drucker bereits mit lebenden Zellen. So sollen künftig künstliche Organe entstehen.

3D-Drucker-Replik der „Venus vom Hohlefels”.
Die hier gezeigte Replik wurde mittels eines 3D-Druckers
der Bauart Stereolithografie hergestellt.
Quelle: Thilo Parg / Wikimedia Commons, Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Venus vom Hohlefels (auch Venus vom Hohle Fels)
ist eine etwa 6 Zentimeter hohe, aus Mammut-Elfenbein geschnitzte Venusfigurine,
die im September 2008 bei Ausgrabungen in der Karsthöhle Hohler Fels
(historisch auch Hohlefels) am Südfuß der Schwäbischen Alb bei Schelklingen entdeckt wurde.
Die Schichtenfolge (Schicht Va und Vb) des Aurignacien,
in der Fragmente der Venusfigurine gefunden wurden,
kann naturwissenschaftlich auf mindestens 31.000,
höchstens 35.000 14C-Jahre datiert werden,
was einem kalibrierten Kalenderalter von 35.000 - 40.000 Jahren entspricht.
Somit ist die Venus vom Hohlefels
die weltweit älteste gesicherte Darstellung eines Menschen.
2 noch ältere Fundstücke aus Israel bzw. Marokko,
die von einigen Archäologen ebenfalls als Venusfigurinen gedeutet wurden
(Venus von Berekhat Ram und Venus von Tan-Tan),
werden mehrheitlich als Naturspiele gewertet.
Wie könnte sich der 3D-Druck auf die Logistik auswirken?
„Logistikunternehmen werden am Wachstum und an der Ausbreitung des 3D-Drucks teilnehmen und Material, Druck-Geräte und Ersatzteile für die Drucker transportieren”, erklärte ein Sprecher der Deutschen Post DHL. Während heute z.B. nach Produktionsende eines Gebrauchsgutes die Ersatzteile jahrelang auf Lager gehalten werden müssen, ist denkbar, dass künftig ein Logistikdienstleister die elektronischen Daten in einem virtuellen Lager bereithält und nach Bestellung die Ersatzteile in der Nähe des Verbrauchers per 3D-Druck produziert.
Mögliche Auswirkungen der 3D-Druck-Technologie auf die Logistik beschreibt die Zukunftsstudie der Deutschen Post DHL „Delivering Tomorrow: Logistik 2050”. Eine Kurzbeschreibung der Studie finden Sie in der Chronik KEP Januar bis März 2012
Die Stiftung Warentest hat in test 6/2013 über 3D-Druck berichtet und einen Drucker getestet. Der online-Bericht enthält auch das folgende Demonstrations-Video.
© Stiftung Warentest (2013)
Inzwischen gibt es eine Reihe von Unternehmen, die 3D-Drucke nach den Wünschen ihrer Kunden herstellen. Eines dieser Unternehmen ist die Fa. ncd nietfeld GmbH Rapid Prototyping in Friedrichshafen. Auf der ncd-Website finden Sie unter http://www.rapidprototyping-nietfeld.de/ncd-rapid-prototyping-funktionsweise-video/31.html einen Videoclip, der die Herstellung - den „Druck” - eines Modells „Dieselelektische Antriebssteuerung” - zeigt. Den Clip finden Sie dank der freundlichen Zustimmung der Fa. ncd nietfeld GmbH auch hier.
Mögliche Einsatzbereiche in der Wirtschaft beschreibt die Fa. ncd auf ihrer Website http://www.rapidprototyping-nietfeld.de/ncd-rapid-prototyping-kompetenz/19.html wie folgt:
Ausgekochte Formen - sofort servierbereit
Formen begreiflich zu machen, ist gerade in der Entwicklungsphase so wichtig wie sinnvoll. Sei es, um die Konstruktion zu überprüfen, sei es, um anderen Ihre Produktidee zu veranschaulichen oder um das Bauteil/Objekt sofort „zum Anfassen” zu haben.
Ein überzeugendes Muster
Ihren Kunden können Sie bereits kurz nach Auftragserteilung ein Muster des Produkts in die Hand geben. Das schafft Vertrauen und die Gelegenheit für konstruktives Feedback, das auf echter Anschauung beruht. Stellen Sie sich oder Ihrem Kunden einen 20-Zylinder-Motor oder die komplette projektierte Anlage einfach auf den Schreibtisch!

12 Zylinder Dieselmotor / Foto ncd nietfeld GmbH Friedrichshafen
Ein detailliertes Anschauungsobjekt
Wir skalieren die Prototypen maßstabsgetreu, wobei sowohl Verkleinerungen als auch Vergrößerungen problemlos machbar sind. Ob Hinterschneidungen, Hohlräume, freistehende Leitungen - der faszinierende Detailreichtum der Modelle zeigt Form und Funktionsweise Ihres Produkts wortwörtlich begreifbar und lebensecht.
Ein echter Motivator
Ein solches Modell ist ein echter Motivator und eignet sich hervorragend als Präsent für Kunden, Jubiläen oder als Ausstellungsstück für Messen. Auf Wunsch liefern wir die Prototypen oder Modelle mehrfarbig und fertig aufgebaut in Präsentationskästen.
Ein exklusives Schmuckstück
Brillante Farben und detaillierte Formen erstellt mit einer zukunftsweisenden Technologie - was liegt bei diesen Schlagworten näher, als tatsächlich ein Schmuckstück oder Kunstwerk anfertigen zu lassen. Zu unseren Kunden gehören ebenso Künstler, Designer und Privatpersonen.
Ende des Zitats
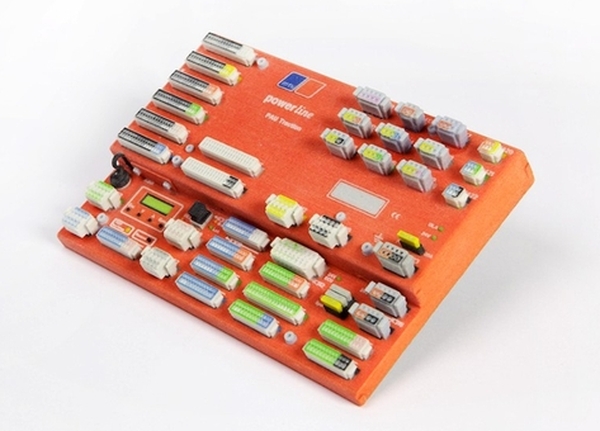
Modell einer dieselelektrischen Antriebssteuerung / Foto ncd nietfeld GmbH Friedrichshafen
Auf ihrer Homepage http://www.rapidprototyping-nietfeld.de/31.html zeigt die Fa. ncd Nietfeld, Friedrichshafen, ein Spezialist für Entwicklung und Konstruktion technischer System, in einem Clip, wie ein 3D-Prototyping Modell im 3D-Druck entsteht. Den Clip finden Sie hier.
*) Das DHL Innovation Center der Deutschen Post wurde 2007 in Troisdorf bei Bonn eröffnet worden. Ziel und Aufgabe des DHL Innovation Centers ist es, aus logistischen Zukunftstrends heraus neue, marktfähige Produkte mit hohem Innovationsgrad zu entwickeln. Dazu vereint das Zukunftslabor alle Stellen, die zuvor im technischen Innovationsmanagement des Konzerns gearbeitet haben, unter einem Dach.
Post rund um den Globus - Deutsche Post DHL Group engagiert sich in vielen internationalen Organisationen
Der Brief nach Fernost steckt in einem schlichten Fensterumschlag. Der Absender geht selbstverständlich davon aus, dass er beim Empfänger ankommt. So einfach das heute scheint: Die Selbstverständlichkeit bedurfte eines jahrzehntelang gewachsenen komplexen Vertragswerks vieler Länder und Organisationen. Darin wird etwa festgelegt, dass das Fenster im Umschlag groß genug ist, damit Menschen und Maschinen in allen Ländern die Adresse lesen können. Dasselbe gilt für die Position des Fensters im Umschlag, die Form der Adresse und so weiter. Geregelt werden müssen Abrechnungsmodalitäten für Transportkosten oder auch der Umgang mit Postsäcken.
Dass der globale Postverkehr an den Grenzen funkioniert, stellen internationale Organisationen sicher, in denen auch die Deutsche Post vertreten ist. Internationaler Konsens ermöglicht es seit nunmehr 141 Jahren, die Erde als einheitliches postalisches Gebiet zu behandeln. Das ist u.a. Heinrich von Stephan (1831-1897), dem Generalpostmeisters des Deutschen Reiches, zu verdanken. Er organisierte nicht nur das Postwesen in Deutschland, sondern war auch Mitbegründer des Weltpostvereins (engl. Universal Postal Union, UPU) mit Sitz in Bern. Die Sonderorganisation der UN basiert auf dem Weltpostvertrag von 1874, der Zusammenarbeit und Rahmenbedingungen im grenzüberschreitenden Postaustausch regelt. Hauptaufgabe bis heute ist die Sicherstellung einer weltumspannenden Zustellung von Briefsendungen, Päckchen und Paketen. Die Mitglieder der UPU sind Staaten, nicht Unternehmen. So wird Deutschland vertreten durch das Bundeswirtschaftsministerium, während die Deutsche Post die praktischen Rechte und Pflichten einer Postverwaltung im Sinne des Weltpostvertrages wahrnimmt.
Eine regionale Union der UPU ist PostEurop. In diesem Verband sind 52 europäische Postdienstleister organisiert - also nicht die Regierungen. Die Deutsche Post ist im Vorstand vertreten und hat eine führende Rolle bei den inhaltlichen Arbeiten. Aufgaben von PostEurop sind die Wahrnehmung der Interessen der Postindustrie gegenüber der Politik in Brüssel aber auch die Verbesserung der Dienstleistungen, der Qualität und Effizienz des europäischen Postnetzes und der Zusammenarbeit der Postunternehmen.
Ferner geht es um grenzübergreifende Themen wie Nachhaltigkeit oder soziale Verantwortung und den Austausch von Erfahrungen urnd Innovationen. Während dies meist einmütig vor sich geht, kann es bei politischen Themen auch schon mal Differenzen geben, wie es etwa bei der Postmarktliberalisierung der Fall war.
Die europäische Organisation für die Expressdienste ist die European Express Association (EEA). In ihr sind die großen Expressdienstleister organisiert, UPS und FedEx, TNT und natürlich auch DHL. Sie hat die Aufgabe, sicherzustellen, dass in der Politik die Herausforderungen des Expressdienstmarkes verstanden werden. Themen der EEA sind die Regulierung des europäischen Postmarktes und der Handel mit Drittländern, Zoll, Sicherheit, Transport und Umwelt. Engste Verbindungen bestehen zur Global Express Association, die die Expressinteressen weltweit vertritt.
Die International Postal Cooperation (IPC, ebenfalls mit Sitz in Brüssel) ist ein Partnerunternehmen der Postindustrie. Hier finden sich die 24 bedeutendsten Postdienstleister aus Europa, Nordamerika und der Asien-Pazifik-Region, die 80 Prozent des Weltbriefvolumens auf sich vereinen. Größte Stakeholder sind Deutsche Post, USPS, Royal Mail und La Poste. Das Leitungsgremium besteht aus den CEOs der Mitgliedsunternehmen. Die IPC ist verantwortlich für die Entwicklung modernster Technologien und Systeme der Qualitätsverbesserung. Sie stellt technische Lösungen und Plattformen bereit, beispielsweise für grenzüberschreitende Retouren. Die IPC kümmert sich auch um die Messung der Laufzeiten von Postsendungen und die Weiterentwicldung technischer Standards. Die Wannen, in denen unser Fensterumschlag Teile seines Postwegs zurücklegt, gehen etwa auf eine IPC-Entwicklung zurück.
Quelle: Postforum Juli/August 2015, eine Veröffentlichung der Deutschen Post AG
Wie teuer darf ein Brief sein?
Neue Preisberechnung beim Briefporto - Price-Cap-Entscheidung
Stand: Dezember 2015
Die Bundesnetzagentur hat am 4. Dezember 2015 dem Antrag der Deutschen Post AG entsprochen und die Briefentgelte ab 1. Januar 2016 genehmigt. Wie teuer darf eigentlich das Briefporto der Deutschen Post sein? Über das neue Berechnungsverfahren informiert die Bundesnetzagentur in ihrer Zeitschrift für Unternehmen, Verbraucher und Medien „VERNETZT”, Ausgabe 3/2015 wie folgt:
Erst auf den zweiten Blick erschließt sich der Sinn der neuen, von der Bundesregierung veranlassten Preisregulierung für das Briefporto beim klassischen Einzelbrief bis 1.000 Gramm. Ziel ist es, der Deutschen Post AG zu ermöglichen, die flächendeckende und personalintensive Versorgung des Bundesgebiets mit ihrem Briefdienst auch in Zeiten starken Wettbewerbsdrucks durch die wachsende digitale Konkurrenz aufrechtzuerhalten. Das neue Berechnungsverfahren ist Grundlage für die Festlegung der Porti zwischen 2016 und 2018.
Ausgangspunkt und Fundament der neuen Preisregulierung ist die Änderung der Post-Entgeltregulierungsverordnung, die die Bundesregierung am 29. April 2015 beschlossen hat und die am 6. Juni 2015 in Kraft getreten ist. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vertritt die Ansicht, dass die seit nunmehr 15 Jahren unveränderte Verordnung an die heutigen stark veränderten Rahmenbedingungen des Briefmarkts angepasst werden musste. Diese Rahmenbedingungen sind vor allem durch die starke Konkurrenz von E-Mail und Messengerdiensten gekennzeichnet. Wurde früher noch per Brief die Ferienwohnung gebucht oder der Kontakt zu den Familienangehörigen gepflegt, geschieht dies heute zunehmend via E-Mail oder Social Media-Portalen. So erreichte die Menge der beförderten lizenzpflichtigen Briefsendungen bis 1.000 Gramm mit insgesamt 17,7 Milliarden Stück im Jahr 2007 ihren Höhepunkt. Seitdem sind die Mengen kontinuierlich gesunken. Im Jahr 2014 bis auf 15,2 Milliarden Briefe - Tendenz weiter fallend.
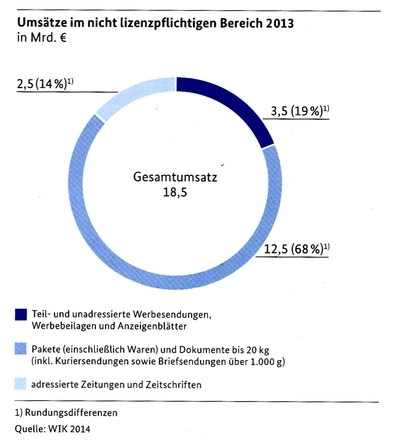
Auf der anderen Seite soll die Grundversorgung, insbesondere mit Briefdiensten, gesichert werden. Und zwar auch dort, wo private Wettbewerber nicht aktiv sind, also vor allem in den dünn besiedelten ländlichen Regionen des Bundesgebiets wie den Halligen und abgelegenen Bergdörfern. Da die Briefbeförderung von der Leerung der Briefkästen über die Sortierung bis zur Verteilung und Auslieferung an die Empfänger ein hochgradig personalintensiver Prozess bleibt, sinken bei schrumpfenden Sendungsmengen die Umsatzerlöse, während die Beförderungskosten aufgrund ihres hohen Fixkostanteils weitgehend unverändert bleiben. Um außerdem das Briefporto auf einem erschwinglichen Preisniveau zu halten, wurde mit der novellierten Verordnung ein neues Preisregulierungsverfahren auf den Weg gebracht. Dieses hat die Bundesnetzagentur nun mit dem Entwurf eines sogenannten Price-Cap-Maßgrößenverfahrens für die Entgelte der Deutschen Post AG ab 2016 umgesetzt und ihre beabsichtigte Entscheidung am 21. Oktober 2015 veröffentlicht. Wettbewerber, Verbraucherschutzorganisationen und andere interessierte Kreise hatten bis zum 11. November 2015 die Möglichkeit zur Kommentierung der geplanten Entscheidung.
Das neue Maßgrößenverfahren
Kernpunkt der Änderung der Post-Entgeltregulierungsverordnung und damit auch der Price-Cap-Maßgrößenentscheidung der Bundesnetzagentur ist die Umstellung der Rentabilitätsberechnung von einer Kapital- auf eine Umsatzrendite. Der Verordnungsgeber ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die z. B. bei Preisregulierungen von Energieversorgern übliche Bezugsgröße des angemessenen kalkulatorischen Gewinns auf Basis branchenüblich verzinsten Eigen- und Fremdkapitals bei der personalintensiven Briefzustellung nicht mehr angemessen war.
Denn Ziel der Verordnungsänderung ist es, dem regulierten Unternehmen im Rahmen der Preisregulierung eine höhere Rendite zur Umgestaltung der Beförderungsnetze zuzugestehen, um auf die wirtschaftlichen Herausforderungen digitaler Konkurrenz angemessen reagieren zu können. Die damit einhergehenden Auslastungsrisiken der hochgradig personalintensiven Briefbeförderungsprozesse sollen bei der Preisgestaltung adäquat berücksichtigt werden.
Das neue Maßgrößenverfahren verwendet deshalb die Umsatzrendite als neue Bezugsgröße, die von der Bundesnetzagentur in einem Vergleichsverfahren mit den Gewinnmargen der lizenzpflichtigen Bereiche regulierter Postunternehmen anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ermittelt wurde. Im Durchschnitt betrug die Umsatzrendite 5,09 Prozent. Im Zuge der Umstellung kommt es zu einer vergrößerten Kostenbasis und einer veränderten Relation von Kosten- und Erlösniveau.

Der Weg zum Briefkasten darf in zusammenhängend bebauten Gebieten
nicht mehr als 1.000 Meter betragen.
Foto Bundesnetzagentur
Als Folge dieser Veränderung musste auch die sogenannte Produktivitätsfortschrittsrate (X-Faktor) angepasst werden. Diese soll für die nächsten 3 Jahre auf insgesamt -5,8 Prozent (zuvor 0,2 Prozent p. a.) festgelegt werden. Die Produktivitätsfortschrittsrate berücksichtigt das Verhältnis von Ausgangsentgeltniveau und dem nunmehr gestiegenen Kostenniveau. Zusammen mit der erwarteten Inflationsrate von l,7 Prozent wird es der Post dann ermöglicht, Preisanpassungen von bis zu 7,5 Prozent für den Zeitraum 2016 bis Ende 2018 vorzunehmen. Das klingt auf den ersten Blick viel, muss aber bei der Betrachtung eines längeren Vergleichszeitraums relativiert werden. Seit der Liberalisierung des Briefmarkts im Jahr 1998 konnte das Preisniveau für Einzelbriefsendungen der Deutschen Post AG über die Jahre verhältnismäßig stabil gehalten werden. Inflationsbereinigt ging das reale Preisniveau bei den wichtigsten Sendungsformaten (Standardbrief, Kompaktbrief, Großbrief, Maxibrief, Postkarte) - trotz der Portoanhebungen in den vergangenen Jahren - um mehr als 22 Prozent zurück (siehe Grafik). Die Entwicklung der Briefpreise blieb in diesem Zeitraum damit immer noch erkennbar hinter dem allgemeinen Lebenshaltungskostenindex zurück.
Ab 2016: 3 Jahre stabile Preise
Bislang konnte die Post jedes Jahr einen Antrag auf Erhöhung der Briefporti stellen. Maßgeblich für die Höhe der portoerhöhung war dabei vor allem die maßgebliche Inflationsrate für das Antragsjahr. Entsprechend niedrig fielen mit jeweils 2 Cent die Erhöhungen des Briefportos in den letzten 2 Jahren aus. Um diese jährlichen geringfügigen Preisanpassungen für den Verbraucher zu vermeiden und auch die Umstellungskosten für neue Briefmarken zu minimieren, wird der Price-Cap-Zeitraum zu einer einzigen 3-jährigen Genehmigungsperiode zusammengefasst. Preisveränderungen über den gesamten Zeitraum bis Ende 2018 können damit einmalig zu Beginn der Regulierungsperiode beantragt werden. Für die Folgejahre sind die Preise dann stabil zu halten. „Damit erhöhen wir die Planbarkeit der Preismaßnahmen der Deutschen Post. Die Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich nicht mehr auf jährlich verändernde Preise einstellen”, erläuterte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur.
| Grundversorgung mit Postleistungen
In Deutschland regelt die Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) die Grundversorgung mit Postdienstleistungen. Die Brief- und Paketzustellung muss einmal werktäglich erfolgen, durch Einwurf in den Briefkasten oder durch persönliche Aushändigung. Bundesweit muss es mindestens 12.000 stationäre Möglichkeiten geben, Briefe in einer Postfiliale aufzugeben oder in einen Briefkasten einzuwerfen. Der Weg zum Briefkasten darf in zusammenhängend bebauten Gebieten nicht mehr als 1.000 Meter betragen. Die Auslieferung von 80 Prozent der inländischen Briefe hat an dem Werktag nach dem Einlieferungstag zu erfolgen. |
70 Cent für den Standardbrief
Die Deutsche Post AG hat nach Bekanntgabe der endgültigen Price-Cap-Entscheidung der Bundesnetzagentur die Preise für die einzelnen Produkte - wie z. B. für den Standardbrief oder die Postkarte - zur Genehmigung vorgelegt. Dabei hatte die Post bereits im Vorfeld signalisiert, welche Preise sie für welche Briefprodukte beantragen wird. Für diese neuen Wertstufen ist das Erscheinen der passenden Marken bereits für den Zeitraum ab dem 3. Dezember 2015 angekündigt. Neben den bestehenden Marken gibt es dann auch eine neue Ergänzungsmarke im Wert von 8 Cent. Vorhandene Briefmarkenbestände können somit über den Jahreswechsel hinaus genutzt werden, ein Umtausch ist nicht erforderlich. Die wichtigsten Entgeltänderungen für den Inlandsversand werden nach dem Antrag der Deutschen Post AG wie folgt aussehen:
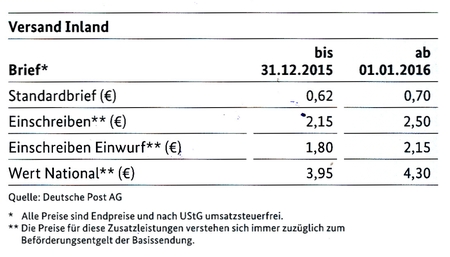
„Mit dem Entwurf des Price-Cap-Maßgrößenverfahrens schaffen wir die Grundlage, dass die Deutsche Post AG die Herausforderungen zunehmender digitaler Konkurrenz stemmen kann und für die Verbraucherinnen und Verbraucher auch weiterhin eine flächendeckende Versorgung zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung steht”, sagte Homann abschließend. Die finanzielle Mehrbelastung für die bundesdeutschen Privathaushalte dürfte nur wenige Euro im Jahr betragen. So fällt das Briefporto im Warenkorb für die Messung der Inflationsrate schon lange kaum noch ins Gewicht.
Stichwörter: Postbank
Meilensteine des Online-Banking
Geschichte

Der Fernseher bringt die Bank ins Wohnzimmer
Foto Deutsche Postbank AG
Online-Banking ist heute so selbstverständlich wie eShopping, Musikdownloads oder der Informationsaustausch durch E-Mails. Wer hätte aber gedacht, dass die Geburtsstunde des heutigen Online-Bankings, im Gegensatz zu vielen anderen Internetaktivitäten, schon mehr als 25 Jahre zurückliegt?
Startschuss auf der IFA
Möglich machte es ein neues Medium in Deutschland: der Bildschirmtext (Btx) - 1974 in Großbritannien als „Viewdata” entwickelt. Den offiziellen Startschuss zu diesem Verfahren gab der ehemalige Postminister Christian Schwarz-Schilling 1983 auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin.

Startschuss auf der IFA 1983:
Bundespostminister Dr. Christian Schwarz-Schilling und
Eric Danke stellen den Bildschirmtext vor
Foto Deutsche Postbank AG
Basierend auf der neuen Technik des Bildschirmtextes startete die Deutsche Post unter der technischen Federführung von Eric Danke einen Feldversuch, um die Möglichkeit der Kontoführung mit diesem System zu testen.
Was heute wie Stoff aus einem veralteten Science Fiction-Streifen anmutet, war damals eine revolutionäre Technologie: Daten wurden per Telefonleitung mit einer Geschwindigkeit von 1.200 bit pro Sekunde übermittelt und auf dem heimischen Fernsehbildschirm sichtbar gemacht.

Die ersten Btx-Geräte: Von den Besuchern der IFA 1983 wurde die neue Technik aufmerksam studiert.
Foto Deutsche Postbank AG
Damals erfreuten sich 3 Bereiche bei den „Btx-Teilnehmern” besonderer Beliebtheit:
- Das Informationsangebot der Presse,
- die Bestellmöglichkeiten des Versandhandels und der Reiseveranstalter und
- das Serviceangebot der Postbank, die zu den Pionieren unter den Banken und Sparkassen zählte.

Btx-Homebanking-Seite in den 1980er- bis in die frühen 1990er-Jahre
Postgirokunden - wie man sie seinerzeit noch nannte - konnten erstmals bequem von zu Hause Überweisungsaufträge erteilen und Kontostände abrufen - ohne dafür einen Beleg auszufüllen oder eine Filiale aufzusuchen.
Um sich vor Dritten zu schützen, entwickelte man ein spezielles Sicherungssystem, das in Grundzügen noch heute gilt: Mit Kontonummer und einer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) erhält der Kunde Zugang zu seinem Konto. Darüber hinaus konnte er mit einer einmal gültigen Transaktionsnummer (TAN), die seine eigenhändige Unterschrift ersetzte, den Auftrag zur Bearbeitung freigeben.
Die frühen Jahre
Die Bundespost hatte die Oberhoheit über die neue Technologie - jeder Anbieter durfte in dem System Inhalte bereitstellen. Thematisch reichten die kostenpflichtigen Seiten von Grußkarten über die Fahrplanauskunft der Bahn bis zu erotischen Inhalten. Die Deutsche Post nahm mit ihrem Angebot „Btx-Postgiro” eine Vorreiterstellung ein. Der Kunde konnte praktisch über ein elektronisches 24-Stunden-Konto verfügen - das heißt von zu Hause aus beispielsweise Überweisungen erteilen und Kontostände abrufen.
1994 feierte die Postbank ihren 300.000. Online-Kunden. Sehr bald wurde das inzwischen T-Online genannte Verfahren von einer revolutionierenden Technik in den Schatten gestellt - das Internet hielt immer mehr Einzug. Im Juli 2005 wurde das Btx-System endgültig eingestellt.
| „(Btx)... dürfte einen stärkeren Wandel in der Alltagskultur einleiten als die Ausweitung von Fernsehprogrammen...” (Helmut Kromrey; Bochumer Medienforscher; 1983 „... Gemütlich bei einem Glas Bier die Bankgeschäfte von zu Hause aus erledigen ist nun kein Problem mehr...” (Nordhäuser Wochen Chronik; 30.09.92: Gemütlich bei einem Glas Bier) |
Frühes Homebanking - Aufbruch ins Internet
Die Öffentlichkeit nahm die Btx-Technologie sehr zurückhaltend auf - die Kundenzahlen wuchsen nur allmählich. In 11 Jahren stieg die Zahl der Kunden, die das Btx-Angebot der Postbank nutzten, auf lediglich 300.000. Doch plötzlich ging die Entwicklung in großen Schritten voran. Denn nachdem die Deutsche Telekom 1995 den Btx-Dienst in T-Online umbenannte, warf eine noch spektakulärere Technologie ihre Schatten voraus und stand in den Startlöchern: Das Internet.

Bildschirmtext-Telefon in den 1990er-Jahren
Via Bildschirm und Tastatur konnte man im Homebanking
sein Girokonto bedienen.
Foto Deutche Postbank AG
Der Durchbruch kam mit dem Web
Den Durchbruch in der Bevölkerung schaffte das Online-Banking im Internet. So startete beispielsweise die Postbank ihre Homepage im Jahr 1996.
Auf www.postbank.de informierte die Bank damals im ersten Schritt über die Produkte und das Unternehmen.

Leitseite der Homepage der Deutschen Postbank 1996
Nur 2 Jahre später, im Januar 1998, bot die Postbank als erste Bank in Deutschland das browserbasierte Online-Banking im Internet auf Basis der 128-Bit-Verschlüsselung an. Nun stieg die Zahl der Online-Neukunden rasant. Ein halbes Jahr nach Einführung ihrer Webpräsenz hatte sich der Bestand fast verdoppelt und die Postbank begrüßte den 500.000 Online-Kunden.

Homepage-Leitseite der Deutschen Postbank 1998
Heute hat sich diese Zahl auf rund 4,5 Millionen erhöht. Tendenz steigend.
Das Online-Banking ist heute fester Bestandteil des Alltags. Mit 3,7 Millionen Online-Konten ist die Postbank einer der Marktführer im Bereich des Online-Bankings.
Neben dem optimalen und innovativen Service hat es sich die Postbank zur Aufgabe gemacht, das Online-Banking für seine Kunden so sicher wie nur möglich zu gestalten.
Die Postbank - als Pionier von Anfang an dabei - hat seitdem die Entwicklung vom Btx zum Online-Banking per Internet wesentlich beeinflusst. Noch heute setzt sie dabei Maßstäbe - insbesondere in punkto Sicherheit.
| „Verspüren Sie als PC-Anwender nicht auch manchmal den Drang durch Ihr digitales Arbeitsgerät mit der Außenwelt in Kontakt zu treten?” (PC Connection; 2/94; Datenmarkt für Jedermann) „Dieser Dienst [Btx] legte den Grundstein für eine völlig neue Dienstleistungswelt, lange vor dem Internet.” (Die Welt,Ulrich Clauss,19.12.01, „Online” war Deutschland schon früh) |
Online-Banking heute - Online Banking mit mobileTAN

Die mobileTAN der Postbank (mTAN):
Durch die Kanaltrennung von PC und Handy
erschwert sie Betrügern das Handwerk.
Durch die Anzeige von Betrag und Empfängerkontonummer
sieht der Kunde sofort, ob die Überweisung verändert wurde.
Foto: Deutsche Postbank AG
Der Schlüssel zum Erfolg war der einfache und sichere Zugang zum Internet. Dafür sorgten neben PIN und TAN eine 128-Bit-Verschlüsselung durch den Browser sowie eine Firewall, die den Bankrechner gegen Angriffe von außen schützte. Doch mit der stark fortschreitenden Entwicklung des Internets rief das Online-Banking auch Cyberkriminelle auf die Bildfläche. Eine Betrugsmasche, die heute unter dem Namen „Phishing” bekannt ist, machte im Sommer 2004 erstmals Schlagzeilen: Um Zugriff auf fremde Konten zu bekommen, forderten Betrüger mit gefälschten E-Mails und fadenscheinigen Begründungen Bankkunden auf, PINs und Transaktionsnummern mitzuteilen.
Die Postbank schnürte ein umfangreiches Sicherheitspaket und startete Gegenmaßnahmen. Den Anfang machte ein für die Kunden frei wählbares Überweisungslimit. Kurz danach löste die iTAN die herkömmliche TAN ab. Bei der iTAN (indizierte TAN) ist nur eine bestimmte, vom System vorgegebene (indizierte) TAN von der Liste des Kunden für die Überweisung gültig. Es folgte die Einführung der mTAN (mobile TAN), die der Kunde per SMS auf sein Handy geschickt bekommt. Diese TAN ist nur für eine bestimmte Überweisung und für einen kurzen Zeitraum gültig.
Besonders wichtig für die Sicherheit ist der Kontakt zum Kunden. Für die Fragen ihrer Kunden rund um die Sicherheit beim Online Banking stellt die Postbank eine kostenlose Sicherheitshotline unter 0800-100 8906 sowie eine E-Mail-Adresse unter missbrauch@postbank.de zur Verfügung. Ihr Wissen können die Kunden mit der von der Postbank entwickelten interaktiven Guided-Tour auf ihrer Website testen und erweitern. Für diese Maßnahmen konnte die Postbank aktuell Auszeichnungen entgegennehmen: Bei einem Sicherheitstest vom Internetportal tecChannel.de erreichte sie unter 20 Banken den 1. Platz. Ferner wurde sie Gesamtsieger beim diesjährigen Chip-Bankentest 07/2008. Sie überzeugte die Tester sowohl in puncto Sicherheit als auch mit ihrem umfangreichen Leistungsangebot.
Als führende Online-Bank hat die Postbank eine Vorreiterrolle übernommen und im Jahr 2004 das Handy zur Bankfiliale für unterwegs gemacht. Seither können Postbank Kunden ihre Bankgeschäfte auch per Handy erledigen, zum Beispiel Geld überweisen oder ihren Kontostand abfragen. Das Mobile-Banking ergänzt das erfolgreiche Online-Banking und setzt den Trend fort, unabhängig von Öffnungszeiten zu sein.
Wesentlichen Anteil am Erfolg hat mehr und mehr der Service. Kunden der Postbank können sich den nächstgelegenen Geldautomaten der Cash-Group oder das nächstgelegene Postbank Finanzcenter auf ihrem Handy anzeigen lassen. Außerdem werden sie auf Wunsch via E-Mail oder SMS über Änderungen beim Giro- oder Depotkonto benachrichtigt.

Homepage-Leitseite der Deutsch Postbank AG 2014
Foto Deutsche Postbank AG
Meilensteine
| 1983 | Startschuss Btx: Postbank Online-Banking beginnt (BPM-Pressemitteilung vom 1. September 1983 - PDF -) |
| 1994 | Die Postbank hat 300.000 Online-Kunden |
| 1996 | www.postbank.de: die Postbank geht ins Internet |
| 1998 | Postbank Online-Banking auch im Internet: 500.000 Online-Kunden |
| 2000 | Postbank bietet Direkt-Brokerage an |
| 2001 | Online-Ratenkredit |
| 2003 | Neues Privatkunden-Portal „Postbank direkt”: Premiere der mobilen TAN in Deutschland |
| 2004 | Postbank bringt Mobile-Banking in Deutschland: Online-Überweisungen nun in Echtzeit bundesweit rund um die Uhr / BIENE-Award in Gold |
| 2005 | Postbank führt bundesweit die iTAN ein |
| 2006 | Startschuss für Online-Bezahlverfahren giropay / Als erste Bank signiert die Postbank ihre mails digital / HBCI plus mit PIN und iTAN/mobileTAN |
| 2007 | „Grüne” EV-SSL-Zertifikate / Relaunch der Homepage / Postbank bringt iBanking in Deutschland |
Quelle: Postbank Dossiers (2008)
Finanzen: Wie setzt sich IBAN zusammen?
Juli 2010
IBAN steht für International Bank Account Number. Die IBAN ist die persönliche europaweit gültige Kontonummer. Sie ist dem Girokonto fest zugeordnet.
So setzt sich die IBAN für ein deutsches Konto zusammen
Die IBAN einer deutschen Bank oder Sparkasse hat immer 22 Zeichen. Das mag auf den ersten Blick verwirrend sein, ist es aber nicht. Denn wer genau hinschaut, erkennt viel Bekanntes.
- An den ersten beiden Stellen steht das Länderkennzeichen. Für Deutschland lautet es DE.
- Die beiden nächsten Stellen sind durch eine individuelle Prüfziffer belegt. Diese ist neu. Sie könnte zum Beispiel 31 lauten.
- Danach folgt die 8-stellige Bankleitzahl Ihres Kontos zum Beispiel 20010020.
- Anschließend folgt Ihre bekannte Kontonummer zum Beispiel 9999999999. In unserem Beispiel würde die IBAN also lauten: DE 31 20010020 9999999999
Wie viele Zeichen hat Ihre Kontonummer?
Eine deutsche IBAN hat immer 22 Zeichen. 10 davon sind für die Kontonummer reserviert. Wenn Ihre Kontonummer weniger als 10 Ziffern hat, werden die Stellen zwischen Bankleitzahl und Kontonummer mit der entsprechenden Anzahl Nullen aufgefüllt.
Beispiel: Ihre Kontonummer lautet 22335566. Damit sie 10 Zeichen einnimmt, werden 2 Nullen vor der Kontonummer eingefügt: 00 22335566. Die IBAN lautet dann zum Beispiel: DE 88 10010010 0022335566.
Jetzt IBAN nachschauen und merken
Schauen Sie sich Ihre persönliche IBAN an. Sie finden sie im Kopf Ihrer Kontoauszüge und des Finanzstatus. Merken Sie sich Ihre persönliche 2-stellige Prüfziffer hinter dem Länderkürzel DE.
Hat Ihre Kontonummer 10 Ziffern?
Länderkürzel - Prüfziffer - Bankleitzahl - eventuell „0” - Kontonummer. Wenn man die Ordnung erkannt hat, lässt sich auch die IBAN gut merken.
Übrigens: Zur besseren Übersichtlichkeit soll die IBAN gemäß den Vorgaben in Vierergruppen unterteilt werden. Im Zahlungsverkehr wird eine IBAN aber immer ohne Leerstellen angegeben.
Siehe auch Chronik Postbank April - Juni 2013
Quelle: Deutsche Postbank AG
Stichwörter: Telekommunikation
Glasfaserkabel - Grundlage moderner DatenautobahnenStand: Januar 2009

Sie sind haardünn und megaschnell:
Hochgeschwindigkeits-Glasfasern bilden die Basis
der modernen Datenautobahnen des 21. Jahrhunderts.
Anlass genug, sich die „Wunderleitungen” genauer anzuschauen.
Foto: Vodafone
Glasfaserkabel - auch als Lichtwellenleiter bezeichnet - bestehen aus Quarzglas und übertragen enorme Datenmengen mit Hilfe von Licht. Ihr Zentrum besteht aus einem optisch transparenten Material. Der Kern ist von einem ebenfalls lichtbrechenden Material ummantelt. Es sorgt dafür, dass das Licht im Kabel bleibt. Eine einzige Faser hat einen Durchmesser von wenigen Mikrometern und ist kaum dicker als ein Menschenhaar. Sie ermöglicht die kaum vorstellbare Übertragungskapazität von bis zu 200 Terabit pro Sekunde - 200.000.000.000.000 Bit. Das entspricht der Datenmenge von rund 34.000 CDs. In Überlandnetzen sind mehre 100 Einzelfasern gebündelt, nicht selten bis zu 1.000.
Glasfasernetze sind konventionellen Kupferkabeln oder Satellitenverbindungen haushoch überlegen.
Vorteile:
- deutlich höhere Transportkapazitäten
- Überbrückung sehr großer Distanzen dank einer geringen Dämpfung: mehr als 100 Kilometer sind möglich; für eine Verstärkung sorgen bei Bedarf sogenannte Repeater
- keine „Störung” benachbarter Fasern durch die Datenübertragung
- hohe Abhörsicherheit.
Fakten
In Deutschland gibt es nach Angaben der Bonner Bundesnetzagentur Glasfasernetze mit einer Länge von mehr als 300.000 Kilometern. Vodafone Deutschland und Arcor betreiben die zweitgrößte Infrastruktur in der Republik. Beide Unternehmen haben ein Lichtwellenleiternetz mit einer Länge von rund 50.000 Kilometern aufgebaut.
Quelle: Vodafone Deutschland
Lokalisierung: Wo bin ich? - Lokalisierung über das Handynetz
Stand: 22.01.2009
Die Mobilfunknetze ermöglichen die Lokalisierung von Handys. Das ist gut, wenn man irgendwo mit dem Auto auf der Landstraße liegen geblieben ist oder besorgte Eltern wissen wollen, wo sich ihr Kind gerade aufhält. Weniger gut ist es, wenn man damit heimlich überwacht wird. Daher ist es wichtig, die technische Funktionsweise und die rechtliche Grundlage für die Lokalisierung von Mobiltelefonen zu kennen.

Wenn man irgendwo auf der Landstraße mit dem Auto liegen geblieben ist,
kann man mit dem Handy nicht nur Hilfe rufen,
sondern auch seinen Standort
durch Lokalisierung des Handys ermitteln lassen.
Foto: Vodafone
Ein eingeschaltetes Handy ist immer in Kontakt mit seinem Mobilfunknetz, beispielsweise dem Vodafone-Netz. So kann es jederzeit Anrufe und Kurznachrichten entgegennehmen. Dazu stellen das Handy und einer der nahe liegenden Funkmasten eine Verbindung her. Auf Basis dieser Information wird die Handylokalisierung durchgeführt. Wenn es sich um einen Ballungsraum handelt, sind viele dieser Funkmasten in der Nähe und das Handy kann recht genau lokalisiert werden, falls aber nur wenige Funkmasten in der Umgebung vorhanden sind, ist die Lokalisierung entsprechend ungenauer.
Lokalisierungsangebote eignen sich für viele Zwecke. Beispielsweise gibt es Suchfunktionen für Freunde oder Kinder, Hinweise auf Geschäfte oder Restaurants in der Nähe oder für Unternehmen die Überwachung eines Fuhrparks.
Kritisch ist das sogenannte Tracking immer dann, wenn Menschen heimlich und ohne ihre Zustimmung lokalisiert werden. Das ist technisch möglich, aber illegal. Denn die datenschutzrechtlich zwingende Voraussetzung für die Übermittlung und Nutzung von Standortdaten ist die Einwilligung der Betroffenen, heißt es beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz in Bonn.
Diese Voraussetzung erfüllt Vodafone bereits seit Einführung der kommerziellen passiven Lokalisierung durch den Einsatz eines speziellen sogenannten Privacy Management, welches generell die Basis für die Anmeldung der Kunden zu passiven Lokalisierungsdiensten ist. Findet eine passive Lokalisierung eines Endgerätes statt, so erhält die Person, die im Besitz des Handys ist, nach dem Zufallsprinzip, mindestens aber bei jeder 10. Lokalisierung eine SMS, in der über die Lokalisierung und die Option, diese abzustellen, informiert wird. Durch diese ergänzende Maßnahme sorgt Vodafone dafür, dass eine missbräuchliche Nutzung passiver Lokalisierungsdienste nicht möglich ist.
Nur im Notfall oder auf richterlichen Beschluss darf jedes Handy sofort über die Polizei lokalisiert werden.
Quelle: Vofafone Deutschland
UMTS - die 3. Mobilfunkgeneration / 5 Jahre UMTS
Stand: 11.02.2009
Es begann mit einer Aufsehen erregenden Versteigerung von Funkfrequenzen für rund 50 Milliarden Euro durch die Bundesregierung im Jahr 2000 bei der damaligen Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post in Bonn. Damit wurde der Weg für eine mobile Datenübertragung auf der Überholspur frei gemacht, denn nur 4 Jahre später, am 12. Februar 2004, ging Vodafone als erster Netzbetreiber mit der Vermarktung von UMTS an den Start und läutete damit ein neues Mobilfunk-Zeitalter ein. Nach 5 Jahren und anfänglicher Skepsis nutzen heute 8 Millionen Vodafone-Kunden UMTS.

Am 12. Februar 2004 startete Vodafone als erster Netzbetreiber die Vermarktung von UMTS.
Jürgen von Kuczkowski, der damalige CEO von Vodafone Deutschland,
gab dafür das Startsignal
Foto: Vodafone
Das erste UMTS-fähige Produkt war eine Mobile Connect Card, eine PC-Karte für das Notebook, mit der man mobil ins Internet gehen konnte. Vor der Inbetriebnahme des Netzes führte Vodafone einen Test mit mehreren Tausend Firmenkunden durch. Dieser zeigte, dass das UMTS-Netz und die PC-Karte einwandfrei funktionierten und damit bereit für die Vermarktung waren. Das Vodafone UMTS-Netz war zu diesem Zeitpunkt in mehr als 200 Städten in hoher Qualität verfügbar. Von da an konnten Vodafone-Kunden mobil mit dem Notebook mit bis zu 384 Kilobit/s, also der 6-fachen ISDN-Geschwindigkeit, arbeiten. Die ersten UMTS-Handys folgten im Mai 2004.
Der schnelle mobile Zugriff auf das Firmennetzwerk ist dank UMTS ebenso problemlos möglich wie beispielsweise die Ansicht von multimedialen Webseiten oder das Streaming von Videos. Grenzenloser Internetzugang, Multimedia auf dem Handy und mobiles Arbeiten ist mit dem Mobilfunkstandard der 3. Generation für jeden Wirklichkeit geworden.
Vodafone hat aktuell etwa 20.000 GSM-Basistationen und deckt mit diesen mehr als 99 Prozent der Bevölkerung ab. Mit mehr als 13.000 UMTS-Basisstationen werden mehr als 80 Prozent der Bevölkerung mit mobilem Breitband-Zugang mit Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Mbit/s und im Uplink mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,45 Mbit/s abgedeckt. An mehr als 350 HotSpots in Deutschland werden schon heute Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s und im nächsten Schritt Geschwindigkeiten von bis 14,4 Mbit/s erzielt. In ländlichen Regionen schließt UMTS als mobiles DSL die sogenannten weißen Flecken ohne DSL-Versorgung. Durch UMTS ist der Datenumsatz von Vodafone ohne SMS- und MMS-Versand kontinuierlich auf 1 Milliarde Euro pro Jahr angewachsen.
Die Nachfolgegeneration von UMTS heißt LTE und steht für Long Term Evolution. Diese neue Technologie wird in Zukunft die mobilen Datenraten noch einmal deutlich erhöhen und die verfügbaren Funkfrequenzen noch flexibler und ökonomischer nutzen.
Quelle: Vodafone
Navigation: Mit dem Handy gut ankommen
Stand: März 2009

Viele moderne Handys verfügen über ein eingebautes Navigationssystem und
können damit ihren Besitzer im Auto oder auch zu Fuß bequem ans Ziel bringen.
Wer nur selten unbekannte Ziele aufsucht, muss kein teures Navigationssystem kaufen. Viele moderne Handys verfügen über ein eingebautes Navigationssystem und können damit ihren Besitzer im Auto oder auch zu Fuß bequem ans Ziel bringen.
Ein GPS-Handy ist auch immer dann von Vorteil, wenn man verschiedene Fahrzeuge wie zum Beispiel Leihwagen nutzt. Die Navi-Handys unterscheiden sich in ihren grundlegenden Funktionen kaum von reinen Navigationssystemen. Mit Online-Verkehrsinformationen ermöglichen Navigations-Handys eine automatische Umfahrung von Verkehrsstaus.
Das Kartenmaterial wird durch einen Server permanent auf dem aktuellen Stand gehalten. GPS-Handys verfügen über eine dynamische, bewegte Kartenanzeige inklusive Zoom- und Drehfunktion und geben ihre Routeninformationen auch als Grafik, Text und Sprache aus.
Eine Auswahl der Start- und Zieladressen kann auch aus dem Handy-Adressbuch erfolgen. Ein lokales Adressbuch speichert oft angefahrene Adressen. Der Fahrzeug- oder Fußgängermodus ist frei wählbar.
Die intuitive, fehlertolerante Suche nach Orten, Straßen und Postleitzahlen ermöglicht auch den Abruf von detaillierten Informationen zu zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Der Nachtmodus erleichtert die Nutzung des Navi-Handys bei schlechten Lichtverhältnissen.
Quelle: Vodafone
Glasfaser-Seekabel sorgen für globale Vernetzung
Stand 19.03.2009
Die Verbindung steht sofort: Festnetzgespräche von München zum Mobiltelefon in New York sind heute eine Selbstverständlichkeit. Doch bis das Handy klingelt, saust das Telefonsignal 3-mal durch Glasfaserkabel im Atlantik. Alles in Millisekunden. Kein Zweifel: Telekommunikation verbindet Menschen - weltweit.

Riesige Kabeltrommel an Bord:
Per Schiff verlegt das Unternehmen Seacom Glasfaserleitungen
auf dem Grund der Weltmeere
Beim Anruf von München nach New York rast das Signal durch Festnetze auf dem europäischen Kontinent bis zum Atlantik. Via Glasfaser-Seekabel geht es weiter zur Ostküste der USA. Dort nimmt es ein Mobilfunknetz auf. Hat dieses das Handy lokalisiert und Empfangsbereitschaft ermittelt, wird die Information über den Atlantik nach München zurückgeschickt. In Deutschland startet dann der Aufbau des Telefonates - wieder via Transatlantikkabel übermittelt.
Zu den Pionieren der Telekommunikation gehört der amerikanische Geschäftsmann Cyrus W. Field. Ihm und seiner Crew gelang es im Sommer 1858, das 1. transatlantische Tiefseekabel zwischen Neufundland und Irland zu verlegen.
Am 16. August 1858 wurde das Kabel in Betrieb genommen - mit einem 103 Worte langen Glückwunschtelegramm, das die britische Königin Victoria dem amerikanischen Präsidenten James Buchanan telegrafierte. Die Botschaft kam im Schneckentempo an. Denn pro Stunde konnten nur etwa 10 Wörter übertragen werden. Telefonate über Tiefseekabel waren damals noch nicht möglich.
Anfang des 20. Jahrhunderts gab es bereits mehr als 10 transatlantische Meeresverbindungen. Seekabel, die auch Telefonate übertrugen, kamen ab 1950 zum Einsatz. Die Kommunikation erfolgte bis zu Beginn der 1990er Jahre hauptsächlich über Kupferleitungen. Als Übertragungsmedium spielen diese inzwischen so gut wie keine Rolle mehr.
Das 1. Transatlantiktelefonkabel in Glasfasertechnik nahm im Dezember 1988 seinen Betrieb auf. Es konnte 30.000 Telefonate gleichzeitig übertragen. Seitdem sind die Kapazitäten geradezu explodiert. Die heute auf dem Grund der Weltmeere liegenden Glasfaserkabel transportieren mehr als 1.000 Gigabyte pro Sekunde. Das entspricht 62 Millionen Telefonate.
Ohne leistungsfähige Infrastrukturen in den Ozeanen wäre die heutige globale Sprach- und Datenkommunikation unmöglich. So wird lediglich 20 Prozent des weltweiten Kommunikationsaufkommens via Satelliten vermittelt. Den rasant wachsenden internationalen Verkehr können nur Glasfaserkabel bewältigen. Und die globale Vernetzung schreitet weiter voran. So verlegt das Unternehmen Seacom aktuell Glasfaser-Seekabel von Südafrika nach Indien und Großbritannien. Länge: Insgesamt 15.000 Kilometer.
Das Kabel bringt erstmals dem Osten Afrikas einen Anschluss ans Breitbandzeitalter. Weitere Projekte laufen im Süden und Westen - damit möglichst viele afrikanische Länder pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika auf dem eigenen Kontinent den Datenturbo zünden können.
Quelle: Vodafone
10 Jahre Wettbewerb auf der „letzten Meile” / 14 Millionen Haushalte sind komplett zu neuen Anbietern gewechselt
Stand 19.02.2009
10 Jahre Wettbewerb um den Telefonkunden: Mehr als 14 Millionen Haushalte haben der Telekom schon vollständig den Rücken gekehrt und telefonieren über neue Anbieter. Der Kampf um die Kunden - er entscheidet sich auf der „letzten Meile”. Im Februar 1999 legte der Regulierer erstmals die Preise fest, die Wettbewerber für die Mitnutzung dieses Netzabschnitts an die Telekom zahlen.
„Letzte Meile” ist das Stück eines Telefonnetzes, das von der Vermittlungsstelle im Stadtviertel bis in die Wohnung eines Kunden verläuft. Diese Distanz überbrücken Kupferkabel. Fachleute sprechen auch von Teilnehmeranschlussleitungen (TAL).
Wenn ein Kunde mit seinem Telefon- und Internetanschluss komplett zu einem neuen Anbieter wechselt, mietet der Wettbewerber die Kupferleitung bei der Telekom. Über diese Leitung werden Telefonate und der Internetverkehr bis zur nächsten Vermittlungsstelle, dem Hauptverteiler, transportiert. Die Technik der Telekom-Konkurrenten übernimmt dort die Gespräche sowie die Datenpakete und leitet diese in die Weitverkehrsnetze weiter.
Bundesweit gibt es rund 8.000 Hauptverteiler. Wie in einer Wohngemeinschaft ist dort die Vermittlungstechnik mehrerer Anbieter untergebracht. Allein Vodafone Deutschland und Arcor haben fast 3.000 Hauptverteiler erschlossen. So können sie 66 Prozent aller Haushalte und Gewerbebetriebe Komplettangebote machen.
Im Februar 1999 verordnete der Regulierer einen TAL-Monatspreis von 25,40 Mark. Bis März 2009 zahlten Wettbewerber pro Anschlussleitung 10,50 Euro im Monat an die Telekom. Ab 1. April 2009 hat die Bundesnetzagentur das TAL-Entgelt auf 10,20 Euro gesenkt.
Quelle: Vodafone
Vor 10 Jahren begann die Erfolgsstory DSL: 24 Millionen Breitbandanschlüsse in Deutschland
Stand 27.03.2009
Die Deutschen zünden den Datenturbo. Rund 24 Millionen Haushalte und Unternehmen surften Ende 2008 über schnelle Breitbandanschlüsse im Internet. Mit einem Anteil von über 90 Prozent dominiert die DSL-Technik den Markt. Ihre Erfolgsstory begann vor 10 Jahren.
Ab April 1999 verkaufte die Telekom erstmals DSL-Anschlüsse in Deutschland - zunächst für Unternehmen. Im Juli 1999 folgten Angebote für Privatkunden, die damals für ein Paket aus Telefon- und DSL-Zugang sowie Surftarif rund 200 Mark im Monat zahlten.
Der Breitband-Wettbewerb nahm im Jahr 2000 mit dem Einstieg von Konkurrenten wie Arcor an Fahrt auf. So führte die Eschborner Gesellschaft als erstes Unternehmen im Juni 2000 eine DSL-Flatrate ein. Das Fundament für deren Siegeszug war gelegt. Zunächst entwickelte sich die Nachfrage bei DSL, der Digital Subscriber Line oder - übersetzt - dem digitalen Kundenanschluss, verhalten. Interessenten kämpften gegen einen Tarifdschungel. Viele Unternehmen warben mit Gratis-Angeboten - versteckten die Kosten aber im Kleingedruckten ihrer Anzeigen. Die fehlende Transparenz schreckte viele Verbraucher ab.
Ab Herbst 2004 war Schluss mit den Sternchentexten. Unter dem Motto „Operation Preis” startete Arcor Komplettpakete aus Sprach- und DSL-Anschluss sowie Flatrates fürs Telefonieren und schnelle Surfen - alles zum festen Monatspreis. Mit diesen Paketen forcierte Arcor die Entwicklung: Ab 2005 boomte Breitband - mit jährlichen Steigerungen von mehreren Millionen DSL-Kunden.
Komplettangebote gibt es heute zu einem Monatspreis von weniger als 30 Euro. Jeder 2. Haushalt ist bereits mit Hochgeschwindigkeit im weltweiten Datennetz unterwegs. Und das Tempo nimmt kontinuierlich zu: Nach Berechnungen des Marktforschungsinstitutes Dialog Consult surften Ende 2008 über 80 Prozent der Bevölkerung mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 2 und mehr Megabit pro Sekunde. Ohne Breitbandnetze wäre die Geschichte des Web 2.0 mit interaktiven Anwendungen, mit YouTube und Co. sowie den sozialen Netzwerken à la Wer-kennt-wen unmöglich gewesen. Und in einer globalisierten Wirtschaft ist schnelle Datenkommunikation einer der zentralen Standortfaktoren, von dem die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes immer stärker abhängt.
Das hat auch die Bundesregierung erkannt. Wie die Bundeskanzlerin Angela Merkel am 28. Februar 2009 in ihrem wöchentlichen Podcast verkündete, sollen bis zum Jahr 2014 75 Prozent aller Deutschen ein Surf-Tempo von mindestens 50 Megabit pro Sekunde nutzen können. Die DSL-Geschichte geht in die nächste Runde.
Hier der Clip mit Bundeskanzlerin Angela Merkel:
Quelle: Internetseite der Bundesregierung, lt. „Clip-Eigenschaften”: REGIERUNGonline: „Für diesen Clip sind keine Rechte erforderlich. Es gelten keine Beschränkungen.”
Quelle: Vodafone
Breitband: So werden IP-Netze schneller
Stand März 2009
Nahezu jeder gebraucht das Wort Breitband - aber meinen auch tatsächlich alle das Gleiche? Sprach man in den 1990ern gerne von der „Datenautobahn” Internet, so dreht sich nun quasi alles um deren mehrspurigen Ausbau. Doch tatsächlich bedeutet Breitband nicht, dass die.Kabelstränge des World Wide Web schlicht an Umfang zunehmen und daher breiter werden. Band steht also nicht für das Kabel, sondern vielmehr für „Frequenzband”. Über diese Frequenzen werden die Daten übermittelt.

Die Zukunft heißt Glasfaser -
Daten werden mit Hilfe von Licht übermittelt
Foto: Deutsche Telekom AG
Das Synonym für Highspeed
Bandbreite bezeichnet den Abstand zwischen 2 dieser Frequenzen - je weiter diese auseinander liegen, desto mehr Daten können übertragen werden und desto schneller verläuft die Übertragung selbst. Das Wort Breitband ist im Sprachgebrauch mittlerweile zu einem Synonym für die höhere Geschwindigkeit der gesendeten und empfangenen Daten geworden.
Von ISDN zu DSL
Eng verbunden mit dieser Beschleunigung sind die 3 wichtigen Buchstaben D, S und L. Sie stehen für Digital Subscriber Line, was soviel wie digitale Teilnehmer-Anschlussleitung bedeutet. Durch diese werden die Daten mit einem Vielfachen der Geschwindigkeit transportiert, zu der die Schmalbandtechnologie ISDN in der Lage wäre.
Highspeed und Tempolimit
Sagt man DSL, so war bislang die Technik ADSL gemeint. A wie asymmetrisch weist darauf hin, dass die Daten schneller empfangen, als versendet werden können. Über die Distanz vom Anbieter von Inhalten im Netz, hin zum Kunden, sausen die Daten dann wie auf einer Datenautobahn mit Höchstgeschwindigkeit. Auf dem Weg vom Kunden zurück herrscht dort allerdings ein striktes Tempolimit.
Maßgeschneiderte Technik
Das aktuelle Hochgeschwindigkeitsnetz der Deutschen Telekom AG basiert auf der VDSL-Technik. Wobei V für Very high bitrate steht, da ist der Name Programm. Theoretisch könnten die transportierten Daten mit dieser Technik in beide Richtungen mit gleicher Geschwindigkeit fließen und das rasend schnell. Das Netz der Telekom ist auf den Bedarf des Kunden abgestimmt und hält ein Verhältnis von etwa 10:1 ein. Also erreichen ihn Daten 10-mal schneller, als er sie versendet. Das macht Sinn, da er in erster Linie Konsument ist, der im Internet surft oder das Fernsehprogramm nutzt und nicht Anbieter.
Allein mit Kupfer geht es nicht
Aber auch im Erdreich vollzieht sich ein Wechsel. ADSL-Technik hat eine herkömmliche Telefonleitung genutzt, die sogenannte Kupfer-Doppelader. Werden jedoch gleichschnelle Signale über einen Strang aus solchen Leitungen gesendet, so sinken dadurch Reichweite und Geschwindigkeit der Datenübertragung.
Glasfaser und Kupfer gemeinsam
Die Lösung dieses Problems heißt Glasfaser. Das moderne Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom für VDSL ist ein Hybridnetz aus Glasfaser und Kupfer. Kupferleitungen überbrücken jetzt nur noch die sogenannte Letzte Meile bis zum Kunden, das Herz des Netzwerks ist aus Glasfaser - dem Stoff aus dem die Geschwindigkeitsträume sind.
Quelle: Deutsche Telekom
VDSL - das Breitbandnetz der Zukunft
Stand März 2009
Von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin - die Deutsche Telekom macht Deutschland mit ihrem neuen Netz zur Hochgeschwindigkeits-Nation. Bis Mitte des Jahres 2006 verfügten 10 deutsche Städte über die modernste Kommunikationsinfrastruktur in Europa. Rund 3 Millionen Haushalte werden damit erreicht.

Voll mit modernster Technik -
die Multifunktionsgehäuse der Deutschen Telekom
Foto: Deutsche Telekom AG
Auf der Basis des neuen Hochgeschwindigkeitsnetzes entwickelt die Deutsche Telekom einen neuen Markt für innovative Multimedia-Dienstleistungen. Innovation hat auch ihren Preis, genauer gesagt eine Investition allein in den ersten 10 Städten von rund 500 Millionen Euro.
VDSL macht den Daten Dampf
Das Herzstück dieses Netzes besteht aus Glasfaser. Bereits zur Jahresmitte 2006 hatte die Deutsche Telekom mehr als 10.000 Kilometer davon verlegt und 14.000 Multifunktionsgehäuse aufgestellt. Diese Gehäuse ersetzen die Kabelverzweiger (KVZ) die bislang die Kunden mit dem Netz der Telekom verbunden haben und als „graue Kästen” im Stadtbild wahrgenommen wurden. In den neuen Gehäusen hat neben der bewährten auch VDSL-Technik ihren Platz. Sie macht den Daten Dampf und beschleunigt sie auf bis zu 8-fache Geschwindigkeit von beispielsweise T-DSL 6000.
Digitaler Teilnehmeranschluss
VDSL ist die Abkürzung für Very high bitrate Digital Subscriber Line. Das heißt so viel wie Digitaler Teilnehmeranschluss mit sehr hoher (Daten-)Übertragungsrate. Diese neuste Generation der Datenübertragungstechnik hat eine sogenannte Downstream-Geschwindigkeit von bis zu 50 Megabit und eine Upstream-Geschwindigkeit von bis zu 5 Megabit pro Sekunde. Der Kunde erhält die Daten also 10-mal schneller als er sie versendet.
Glasfaser bis zum Bordstein
Solche hohen Verbindungsgeschwindigkeiten lassen sich über das gute alte Telefonkabel aus Kupfer nur über relativ kurze Distanzen realisieren (300 bis 1.000 Meter). Sprich auf der „letzten Meile” vom Hausanschluss bis auf die Straße, aber nicht bis zur nächsten Vermittlungsstelle. Für das VDSL-Netz der Telekom war es daher notwendig, die neue Breitband-Technik so nahe wie möglich zu den Kunden zu bringen. Sie steckt daher in den Multifunktionsgehäusen und schickt die Daten vom Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetz über die Letzte Meile zum Kunden oder zurück. Diese Ausbauvariante nennt man „Fibre to the curb”, also „Glasfaser bis zum Bordstein”.
Neue Stufe des digitalen Zeitalters
Mit dieser Infrastruktur konnten in 10 deutschen Städten bereits zum Start im Sommer 2006 rund 2,9 Millionen Haushalte - das sind etwa 50 Prozent - die neuen Dienste nutzen, bis zum Jahresende 2006 schon rund 90 Prozent der Haushalte.
Quelle: Deutsche Telekom AG
Die Glasfaser-Techniken: HYTAS
Stand März 2009
Eine auch in Deutschland verbaute Technik für aktive optische Anschlüsse heißt HYTAS. Das Wort HYTAS ist die Abkürzung für „Hybrides Teilnehmer Anschlusssystem”. Wie sich aus der Wort-Konstellation erahnen lässt, handelt es sich bei dieser Technik um einen hybriden Netzaufbau. HYTAS vereint also Glasfaser- und Kupferleitungen in einer Technik.
HYTAS ist eine 1994 von ke Kommunikation-Elektronik entwickelte Technik zur Realisierung von Telefonanschlüssen auf Basis aktiver optischer Komponenten.
Das System wird nach Herstellerangaben weltweit in mehreren Ländern eingesetzt und ist Bestandteil des ISIS-Konzeptes (Integriertes System zur Bereitstellung von Netzinfrastruktur auf optischer Basis) der Deutschen Telekom. Im Gegensatz zu passiven optischen Netzwerken verwendet HYTAS aktive Komponenten.
Quelle: Wikipedia 2009
IPTV: Der Zuschauer wird zum Programmdirektor
09.04.2009
Die Zukunft des Fernsehens ist digital. Und künftig bestimmt der Zuschauer selbst, was er wann schaut. Antenne, Satellit und Kabel bekommen Konkurrenz, denn in Deutschland etabliert sich ein weiteres Übertragungsmedium: IPTV oder Fernsehen über das Internet.
Die auf dem sogenannten Internet-Protokoll (IP) basierte „Ausstrahlung” macht das Fernsehen in Zukunft zu einem interaktiven Medium und noch komfortabler: Mit IPTV wird zum Beispiel zeitversetztes Fernsehen möglich. Damit wird jeder Zuschauer sein eigener Programmdirektor. Darüber hinaus lassen sich Sendungen ganz einfach aufzeichnen. Und Zuschauer können „on demand” - also auf Wunsch und zeitunabhängig - auf Online-Videotheken sowie TV-Archive zugreifen. Mit weit mehr als 100 Sendern bietet IPTV zudem ein breites Spektrum an Programmen, das auch viele Angebote für spezielle Interessen - beispielsweise 24-Stunden-Kanäle für Wellness-Fans oder Liebhaber deutscher Volksmusik - beinhaltet.
Wer IPTV nutzen möchte, benötigt schnelles DSL mit einer Geschwindigkeit von mindestens 6 Mbit/s. Eine Set-Top-Box, die vom Anbieter mitgeliefert wird, überträgt das TV-Signal auf den Fernsehapparat.
Quelle: Vodafone D2 GmbH
Datenübertragung - Auf der Überholspur mit hoher Bandbreite
29.05.2009"
Schon heute erreichen Mobilfunknetze Übertragungsraten von bis zu 7,2 Megabit pro Sekunde und damit die Geschwindigkeit von DSL-Verbindungen. Aber was bedeuten diese Angaben für den Anwender dieser Technologien, wenn er beispielsweise ein Digitalfoto von einem Megabyte Dateigröße herunterladen will?
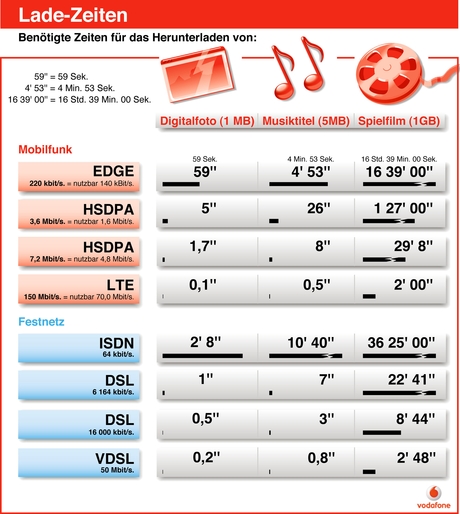
Ein hohe Bandbreite sorgt dafür, dass hohe Datenvolumen schnell im Mobilfunk- oder Festnetz übertragen werden können. Mit der aktuell verfügbaren mobilen Übertragungstechnik HSDPA von 7,2 Mbit/s dauert das Herunterladen eines ein Megabyte großen Digitalfotos 1,7 Sekunden, ein Musiktitel mit 5 Megabyte wird in 8 Sekunden übertragen und ein Film von 90 Minuten Länge und einem Gigabyte Daten in 29 Minuten.
Je nach Geschwindigkeit brauchen die DSL-Netze für die Übertragung von Daten beispielsweise 3 Sekunden für ein Digitalfoto, 7 Sekunden für einen Musiktitel und 22 Minuten für einen Film. Die Übertragungsgeschwindigkeiten reichen derzeit bis zu 16 Mbit/s.
Vodafone hat aktuell etwa 20.000 GSM-Basistationen und versorgt mit diesen mehr als 99 Prozent der Bevölkerung mit einem Mobilfunk-Zugang. Mehr als 13.000 UMTS/HSPA-Basisstationen decken über 80 Prozent der Bevölkerung mit einem mobilen Breitband-Zugang mit Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Mbit/s und HSUPA mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,45 Mbit/s ab. An mehr als 650 HotSpots in Deutschland werden schon heute Geschwindigkeiten von bis zu 7,2 Mbit/s und im nächsten Schritt Geschwindigkeiten von bis 14,4 Mbit/s über HSDPA erzielt. Überall dort, wo aktuell noch keine Versorgung mit HSDPA und HSUPA gegeben ist, wird EDGE angeboten.
Quelle: Vodafone D2 GmbH
50 Jahre CEPT: Pionier des GSM-Mobilfunkstandards feiert Geburtstag
26.06.2009

Eines der ersten GSM-Handys in Deutschland
war der legendäre „Knochen” von Motorola
Foto: Vodafone D2 GmbH
Sie gehört zu den Pionieren des digitalen Mobilfunks: die Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications - kurz CEPT. Am 26. Juni 2009 feierte die Europäische Konferenz der Verwaltungen für Post und Telekommunikation ihren 50. Geburtstag.
Die von 19 staatlichen Post- und Telekommunikationsunternehmen gegründete CEPT zählt zu den Wegbereitern des digitalen Mobilfunkstandards GSM. Das „Global System for Mobile Communications” verhalf der Handy-Kommunikation in den 1990er Jahren zum Durchbruch. Nach dem Vermarktungsstart setzte sich GSM schnell als der weltweit am meisten verbreitete Standard durch.
1982 beschlossen 26 europäische Telekommunikations-Unternehmen die Gründung einer CEPT-Arbeitsgruppe, die bereits unter dem Kürzel GSM firmierte. Diese „Groupe Spécial Mobile” sollte einen einheitlichen paneuropäischen Mobilfunkstandard erarbeiten. Grenzüberschreitende mobile Kommunikation - heute eine Selbstverständlichkeit - war damals die Vision. Bereits 3 Jahre später unterzeichneten Deutschland, Frankreich und Italien einen ersten Entwicklungsvertrag für den neuen Standard. 1987 verständigten sich die Telekommunikationsanbieter auf einen Fahrplan für die Markteinführung.
1 Jahr später gründete die CEPT das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI). Unter dem Dach der neuen Standardisierungsorganisation setzten die GSM-Experten 1989 ihre Arbeit fort. Das Projekt erhielt zusätzliche Dynamik, weil bei der ETSI Netzbetreiber, Hersteller und Regulierer an einem Tisch saßen.
In Deutschland wurde das erste kommerzielle Telefonat mit einem Handy am 30. Juni 1992 geführt - im GSM-Netz von Vodafone (damals D2). Der Siegeszug des Mobilfunks konnte beginnen.
Die CEPT ist heute eine Dachorganisation der Regulierungsbehörden und Ministerien aus 48 europäischen Staaten. Das für Telekommunikation zuständige Büro der CEPT hat seinen Sitz in Kopenhagen. Als Forum für regulatorische Themen im Post- und Telekommunikationssektor will die CEPT die Zusammenarbeit der Mitgliedsorganisationen auf europäischer Ebene fördern und so zu einer Harmonisierung der nationalen Regelungen beitragen. Auch mit Fragen der Frequenzverwaltung beschäftigt sich die Konferenz.
Quelle: Vodafone
WAP - 10 Jahre mobiles Internet
05.06.2009
Vor 10 Jahren kamen die ersten Handys auf den Markt, die einen Vorgeschmack auf das mobile Internet gaben. Sie waren in der Lage, Internetseiten mit Hilfe des „Wireless Application Protocol” (WAP) auf ihrem Display darzustellen.
Das 7110 von Nokia war das erste WAP-fähige Handy weltweit. Es zeichnete sich durch sein großes Schwarz/weiß-Display und durch eine Klappe, die zum Schutz der Tastatur gedacht war, aus. Da das Telefon zeitgleich mit dem Kino-film „Matrix” erschien und einen dort gezeigten Sprungmechanismus hat, wird es häufig als das Matrix-Handy bezeichnet.
2002 folgten die ersten Geräte mit Displays, die auch Farben darstellen konnten, wie zum Beispiel das Ericsson T68. Mit einer Ansteckkamera konnte man mit diesem Handy schon Fotos machen und als MMS versenden.
2003 präsentierte Vodafone das Sharp GX10 mit integrierter Kamera und dem direkten Zugriff auf das Vodafone live!-Portal. Alle diese Modelle arbeiteten mit GPRS, dem „General Paket Radio Service”. Dieser erreicht mit 57,6 kbit/s eine Übertragungsrate mit der es erstmalig möglich war, Bilder und Töne mobil zu übertragen.
2004 ging das mobile Internet dann endgültig mit UMTS auf die Überholspur. Jetzt war es möglich mit 384 kbit/s Daten mobil zu übertragen. Eines der ersten UMTS-Handys in Deutschland von Vodafone war das Samsung Z100. Mit ihm konnte man erstmals Handy-TV auf dem Display verfolgen und Musikstücke und Klingeltöne schnell herunterladen.
Heute ist ein Smartphone wie das HTC Magic der aktuelle Stand der Technik. Vergleicht man es heute mit einem WAP-Handy von einst, kann man schon äußerlich feststellen, was diese 10 Jahre technische Weiterentwicklung bedeuten. Moderne Smartphones besitzen eine Kamera für Fotografie und Video. Ihr satter Sound ersetzt vielfach den MP3-Player und mit GPS kann man sich an jedem Ort der Welt schnell orientieren und den Weg ans Ziel finden. Hohe Bandbreiten von bis zu 7,2 Mbit/s sorgen für schnellen Datendurchsatz auf dem Handy und so für schnellen, mobilen Zugriff auf das Web. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Anwendungen für die Unterhaltung, die Organisation des Alltags oder die Kommunikation mit Freunden per Facebook, Youtube oder Twitter handelt.
Quelle: Vodafone D2 GmbH
Android
01.06.2009
Android ist ein Betriebssystem und auch eine Software-Plattform für mobile Geräte wie Smartphones, Mobiltelefone und Netbooks, die von der Open Handset Alliance entwickelt wird. Ein großer Teil der Software ist frei und quelloffen.
Am 5. November 2007 gab Google bekannt, gemeinsam mit 33 anderen Mitgliedern der Open Handset Alliance ein Handy-Betriebssystem namens Android zu entwickeln. Das Android Betriebssystem ist freie Software und wird unter der Apache-Lizenz 2.0 veröffentlicht.
Als erstes Gerät mit Android als Betriebssystem kam am 22. Oktober 2008 das HTC Dream unter dem Namen T-Mobile G1 in den USA auf den Markt.
Quelle: Wikipedia
Videokompression: Handy TV-fähig dank Videokompression
28.08.2009
Dienste wie YouTube und die Vodafone Videothek liefern von selbstgemachten Filmchen bis zu aktuellen Blockbustern Videos in bester Qualität auf PCs und Handys. Möglich wird das erst durch die sogenannte Videokompression. Sie macht aus riesigen Dateien Videos, die auch in Echtzeit übertragen werden können. Bekannt ist dieses Komprimierungsverfahren unter dem Namen MPEG. Die kryptische Abkürzung steht für „Moving Picture Experts Group”.
Wesentlich mit entwickelt hat diese Verfahren Prof. Dr. Thomas Wiegand mit seinem Team. Die Vodafone Stiftung für Forschung verlieh dem Wissenschaftler, darum im Juli 2009 den mit 25.000 Euro dotierten Vodafone Innovationspreis 2009. In den USA hatte Wiegand, der an der Technischen Universität Berlin sowie am Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut arbeitet, bereits den begehrten Filmpreis „Emmy” in der Kategorie Technik erhalten.
Der Videokodierstandard erhöht die Geschwindigkeit der Bildübertragung um das 2- bis 3-fache und ermöglicht so ruckelfreie und brillante Bilder im Digitalfernsehen, im Internet oder auf dem Handy. Vereinfacht dargestellt, funktioniert das Verfahren so, dass von jedem Bild nur die Teile gespeichert und übertragen werden, die sich von Bild zu Bild verändern.
Thomas Wiegand und seine Mitarbeiter haben mehrere Jahre lang an der Software gearbeitet. Mit Erfolg: Der Videokodierstandard H.264 ermöglicht erste Multimedia-Anwendungen, die auf dem Streaming qualitativ hochwertiger und kompakter Bewegtbilder über das Web basieren. Von dem Verfahren. profitiert besonders die drahtlose Übertragung.
Quelle: Vodafone D2 GmbH
Verkehrsinformationssysteme: Staufrei durch Stadt und Land
02.07.2009
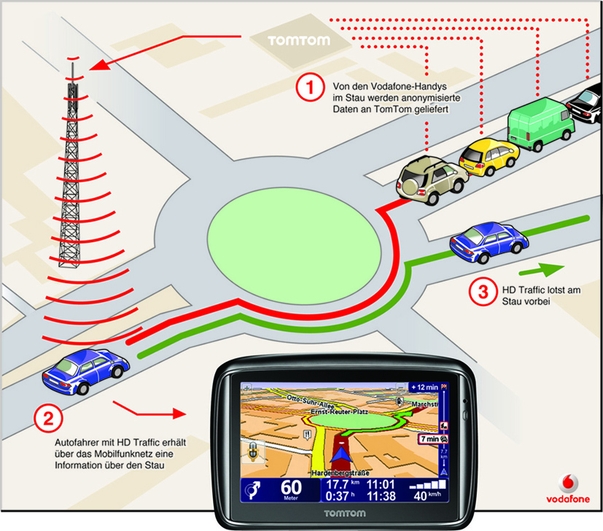
Immer mehr Autofahrer nutzen Navigationsgeräte. Ob fest im Auto eingebaut, mobil oder direkt im Handy integriert. Die geführte Navigation ist besser und sicherer als Kartenlesen auf dem Beifahrersitz. Noch besser wird Navigation durch intelligente Verkehrsinformationssysteme, die auch anonymisierte Daten aus dem Mobilfunknetz nutzen. Denn die sorgen dafür, dass man nicht nur den kürzesten oder schnellsten Weg findet, sondern nach Möglichkeit auch staufrei ans Ziel kommt. HD Traffic nennt sich dieser innovative Service.
Um ein immer aktuelles Gesamtbild der Verkehrslage liefern zu können, nutzt HD Traffic gleich mehrere Quellen. Dazu gehören die auch von Radiosendern im Verkehrsfunk ausgestrahlten TMC-Informationen sowie Daten von Straßenmeistereien und Messpunkten entlang viel befahrener Strecken. Besonders schnell, präzise und aktuell werden die Verkehrsinfos durch anonymisierte Mobilfunkdaten, die TomTom, weltweit führender Anbieter von Navigationsgeräten, von Vodafone erhält. Ausgewertet werden Standortdaten der Handybesitzer. Computerprogramme erkennen, wo sich sehr viele Handy-Nutzer zugleich aufhalten und langsamer bewegen als üblich. Wenn also zahlreiche Vodafone Kunden zeitgleich mit 30 statt 100 km/h auf einer Autobahn fahren, kann TomTom frühzeitig einen Stau erkennen und Besitzer von entsprechenden Navigationsgeräten auf eine Ausweichroute schicken.
Die Infos stellt TomTom den Nutzern seiner neuesten Navigeräte und auf einer Karte sowie in einer Listenansicht im Internet zur Verfügung. Verkehrsbehinderungen und Staus auf Autobahnen, Bundes- und kleineren Straßen lassen sich für ganz Deutschland, ein Bundesland oder einzelne Großstädte anzeigen. Alle 3 Minuten erfolgt eine Aktualisierung.
Quelle: Vodafone D2 GmbH
USB Modem: Das Innenleben eines Daten-Sticks
16.07.2009
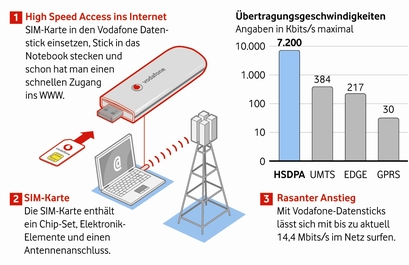 Die Nutzung mobiler Datendienste mit Note- und Netbooks erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Allein bei Vodafone stiegen die Datenumsätze im vergangenen Jahr um 21 Prozent. Die Gründe dafür sind attraktive Datentarifangebote, aber auch der einfache Umgang mit USB-Modems, den sogenannten Daten-Sticks. Die mobilen Modems funktionieren wie ein Handy und ermöglichen den schnellen Internetzugang per tragbarem Computer überall aus dem Mobilfunknetz.
Die Nutzung mobiler Datendienste mit Note- und Netbooks erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Allein bei Vodafone stiegen die Datenumsätze im vergangenen Jahr um 21 Prozent. Die Gründe dafür sind attraktive Datentarifangebote, aber auch der einfache Umgang mit USB-Modems, den sogenannten Daten-Sticks. Die mobilen Modems funktionieren wie ein Handy und ermöglichen den schnellen Internetzugang per tragbarem Computer überall aus dem Mobilfunknetz.
Der Daten-Stick ähnelt einem Speicher-Stick und wird ebenfalls in den USB-Eingang des Net- oder Notebooks eingesteckt. Wenige Sekunden später ist man im Netz und kann überall aus dem Mobilfunknetz E-Mails per Note- oder Netbook senden und empfangen oder im Internet surfen Treiber und Software starten automatisch. Aber wie stellt ein Daten-Stick den Zugang zum Internet her?
Ein Daten-Stick bzw. das USB-Modem ist ähnlich wie ein Handy aufgebaut. Der Zugang ins Internet erfolgt also wie bei einem Telefonat. Im Inneren des Modems befinden sich ein Chip-Set, Elektronik-Elemente, der Antennenanschluss und eine Vodafone-SIM-Karte. Damit baut das USB-Modem eine Verbindung mit dem Vodafone-Mobilfunknetz auf und sorgt für den Datentransfer.
Bis zu aktuell 7,2 Mbit/s sind mit einem USB-Modem beim Empfang von Daten per HSDPA (= High Speed Downlink Packet Access) möglich. Die bekanntesten Hersteller solcher Sticks sind Huawei und ZTE.
Quelle: Vodafone D2 GmbH
Machine-to-Machine: Wenn Maschinen miteinander kommunizieren
24.07.2009

Machine-to-Machine:
Sicherheitsroboter überwachen beispielsweise Fußballstadien
mithilfe der mobilen Machine-to-Machine-Kommunikation
Foto: Vodafone D2 GmbH
Machine-to-Machine (kurz M2M) steht für den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Containern mit einer zentralen Leitstelle. So ist auch die Fernüberwachung, -kontrolle und -wartung von Maschinen, Anlagen und Systemen möglich, die traditionell als Telemetrie bezeichnet wird. Die M2M-Technologie verknüpft Informations- und Kommunikationstechnik mit der Mikrosystemtechnik sowie Logistik. So entsteht ein Internet intelligenter Dinge - das sogenannte „Internet der Dinge”.
M2M-Lösungen können in jedem Wirtschaftszweig Arbeitsabläufe rationalisieren und zu Produktivitätssteigerungen führen. Zum Beispiel melden sich Verkaufsautomaten selbstständig bei einem zentralen Rechner, wenn sie neu bestückt werden müssen. Regelfahrten des Automatenbetreibers können so vermieden werden. Darüber hinaus kommt es zur Vermeidung von Ausfallzeiten. Die damit verbundenen Rationalisierungen der Geschäftsprozesse und die daraus folgenden Kosteneinsparungen bergen für die Industrie - und auch für die Gesellschaft - ein riesiges Potenzial.
Vodafone führt eine globale „Machine to Machine” (M2M)-Serviceplattform ein, die Firmen helfen soll, umfangreiche drahtlose M2M-Projekte zu nutzen und zu verwalten. Die neue Plattform wird zusätzlich durch ein Expertenteam mit weltweiter Zuständigkeit für das Wachstum des M2M-Geschäftes von Vodafone unterstützt. Die drahtlose M2M-Kommuniktion soll den Service für Geschäftskunden beispielsweise in den Bereichen Smart Metering (intelligente Zähler), Connected Cars (vernetzte Autos) und bei der Fernüberwachung von technischen Einrichtungen verbessern.
2008 betrugen die Einnahmen der Betreiber drahtloser M2M-Lösungen weltweit 3 Milliarden Euro. Die Marktforscher von der Analystenfirma Berg Insight prognostizieren bis 2012 einen Anstieg auf 8,9 Milliarden Euro.
Vodafone wird seinen Kunden eine zentrale Anlaufstelle zur Bewältigung des komplexen Bereichs der M2M-Verbindungen, von der ersten Konzeptentwicklung bis hin zur Unterstützung bei nationalen und multinationalen Anwendungen zur Verfügung stellen.
Quelle: Vodafone D2 GmbH
Rundfunktechnik DVB: Digital fernsehen und Radio hören/
Die neue digitale Fernsehnorm heißt Digital Video Broadcasting (DVB)
04.05.2008
 Es gibt sie in 3 Basis-Varianten und jede ist bestens für ihren Übertragungsweg angepasst:
Es gibt sie in 3 Basis-Varianten und jede ist bestens für ihren Übertragungsweg angepasst:
- DVB-T (terrestrial) für die drahtlose Übertragung von digitalen Programmen über terrestrische Sender,
- DVB-C (cable) im Kabel und
- DVB-S (satellite) über Satellit.
Da es sich um ein vollständig digitales System handelt, ist der gleichzeitige Transport von Fernseh- und Radioprogrammen sowie unterschiedlichster Zusatzdienste technisch möglich.
Seit einiger Zeit sind bereits auch Weiterentwicklungen der Basisvarianten spezifiziert: So ist DVB-H (for handhelds) eine Variante von DVB-T, speziell entwickelt für kleine batteriebetriebene Geräte wie Handys oder Taschenfernseher mit sehr kleinem Display. DVB-S2 ist dagegen eine Weiterentwicklung des DVB-S-Standards für die Satellitenübertragung. DVB-S2 steigert die mögliche Datenrate durch die Verwendung verbesserter Kodierungs-, Modulations- und Fehlerkorrekturverfahren. Zum Empfang sind eigene für diese Standards geeignete Geräte nötig.
Digital empfangen
Für den Empfang von digitalem Fernsehen ist ein zusätzlicher Digitalreceiver notwendig. Weil der meist auf, neben oder unter dem Fernseher steht, heißt er auch „Set-Top-Box”. Daneben gibt es auch TV-Geräte mit eingebautem Digitalreceiver. Je nachdem ob man im Kabel, über Satellit oder über Antenne empfängt, ist darauf zu achten, den richtigen Receiver für den gewünschten Empfangsweg einzusetzen. Konkretes Beispiel: Ein reiner DVB-C-Empfänger für digitales Kabelfernsehen kann nicht für den DVB-T-Empfang über Antenne genutzt werden oder umgekehrt. Für den Empfang von interaktiven und multimedialen Zusatzdiensten muss der Receiver außerdem MHP-tauglich sein.
Während das digitale Programmangebot über Antenne (DVB-T) je nach Bundesland und Startregion variiert, bietet die ARD über Satellit und im Kabel ein einheitliches Programmbouquet unter dem Markennamen ARD Digital.
Recht beliebt sind heute Festplatten-Receiver. Sie zeichnen Sendungen auf einer eingebauten Festplatte auf, die viele Stunden Material aufnehmen kann. Praktisch ist das, wenn man mal zu spät zum „Tatort” kommt: Wer die Sendung einprogrammiert hat, kann den Krimi trotzdem von Anfang an sehen, während die Festplatte im Hintergrund weiter aufzeichnet.
ARD DIGITAL: Mehr vom Fernsehen
ARD Digital ist die digitale Programmfamilie der ARD. Alle TV- und Radioprogramme der ARD-Rundfunkanstalten sowie zahlreiche interaktive, programmbegleitende Dienste gehören dazu. Wie groß das Angebot ist, aus dem man zu Hause wählen kann, hängt davon ab, ob man die Fernsehprogramme digital über Antenne (DVB-T), Kabel (DVB-S) oder Satellit (DVB-S) empfängt. Dabei ist über Satellit das komplette Angebot von ARD-Digital empfangbar. Alle Programme sind unverschlüsselt und ohne Extrakosten empfangbar. Zum Angebot gehören auch 3 spezielle digitale TV-Programme: EinsPlus ist der Ratgeber- und Servicekanal mit Sendungen aus dem Ersten und der ARD-Landesprogramme. EinsExtra bietet ein umfangreiches Informationsangebot und EinsFestival ist ein vielfältiges Unterhaltungsangebot mit Filmen, Serien, Dokumentationen und Musik.
Quelle:![]()
HDTV - Digitales Fernsehen
03.08.2009
Das digitale Fernsehen liefert eine maximale Bild- und Tonqualität und schöpft damit die Möglichkeiten des herkömmlichen SDTV-Standards (Standard Definition Television) voll aus. In eine neue Dimension des Fernsehens stößt das brillante, hochauflösende Format HDTV (High Definition Television) vor. HDTV steht für ein Fernseherlebnis, das mit einem Live-Erlebnis vor Ort vergleichbar ist. Und das sowohl mit Blick auf das Bild als auch auf den Ton. Die Fernsehbilder sind weitaus schärfer, klarer und farbintensiver als beim Standardformat SDTV. HDTV kann noch einmal 5-mal mehr Bildpunkte als der heutige Fernsehstandard SDTV darstellen - selbst kleinste Details werden mit dieser Auflösung sichtbar. Dank Dolby Digital erreicht auch der Ton Kinoqualität.
Bei der Entscheidung für die ideale HD-Bildauflösung stand für die ARD das „bessere Bild” im Mittelpunkt des Interesses. Neben der Auflösung des einzelnen Fernsehbildes wurde auf die optimale Darstellung von bewegten Bildern geachtet. Die Zuschauer sollen auch bei schnelleren Bewegungen HDTV ohne Unschärfen genießen können. Das Format 720p/50 liefert dafür eindeutig die besten Ergebnisse. Bei diesem Auflösungsformat werden doppelt so viele Vollbilder pro Sekunde übertragen wie etwa beim Format 1080i/25 und der Schärfeeindruck bewegter Szenen ist deutlich besser. Die ARD wird HDTV deshalb im Format 720p/50 ausstrahlen.
 HDTV-Begeisterte konnten sich in diesem Jahr 2009 bereits zur Leichtathletik-WM und zur IFA einen Eindruck vom Fernsehen in HD-Qualität verschaffen. Vor dem Start des HDTV-Regelbetriebes zu den Olympischen Winterspielen im Februar 2010 startet die ARD zur Weihnachtszeit einen weiteren HDTV-Testlauf im Ersten HD und in Einsfestival HD.
HDTV-Begeisterte konnten sich in diesem Jahr 2009 bereits zur Leichtathletik-WM und zur IFA einen Eindruck vom Fernsehen in HD-Qualität verschaffen. Vor dem Start des HDTV-Regelbetriebes zu den Olympischen Winterspielen im Februar 2010 startet die ARD zur Weihnachtszeit einen weiteren HDTV-Testlauf im Ersten HD und in Einsfestival HD.
Mit dem Start des Regelbetriebs wird der Anteil an nativen HD-Produktionen - also den bereits in HD-Auflösung produzierten Sendungen - Schritt für Schritt erhöht. Den Anfang machen besonders beliebte Sendungen wie die Krimireihe Tatort, Dokumentationen, Fernsehfilme, aber auch Sportereignisse, die in HD produziert und ausgestrahlt werden. Die einzelnen Landesrundfunkanstalten investieren nach und nach in die HD-Technik, um selbst immer mehr Programm in HDTV produzieren zu können.
Quelle: ARD
Rundfunktechnik: HDTV ante portas
03.09 2009
HDTV-Fernseher liegen voll im Trend. 30 Prozent der deutschen Haushalte haben bereits einen. ARD und ZDF werden ab den Winterspielen 2010 in Vancouver zusätzlich zum Standardfernsehen in HDTV senden. Wer auf die neue Technologie umsteigen will, sollte jedoch einiges beachten.
Bei den HDTV-Pionieren waren die Fernsehapparate noch groß, schwer und teuer. Bereits 1985 testete der BR als erste deutsche Rundfunkanstalt den Umgang mit der damals noch analogen HDTV-Technik. In den 1990er Jahren verebbten dann mangels Kundeninteresse die Diskussionen um die Einführung dieser Technik. Zumindest in Europa war für lange Zeit nichts mehr von hochauflösendem Fernsehen zu hören.
Von der alten Idee zum neuen Zugpferd
Aus dem Dornröschenschlaf erweckt wurde HDTV durch die Einführung digitaler Technologien. Sowohl die Verfügbarkeit von erschwinglichen HDTV-tauglichen Fernsehgeräten und Receivern, als auch das steigende Angebot an HDTV-Kanälen und -Produktionen führten dazu, dass hochauflösendes Fernsehen wieder in das Blickfeld der Endkonsumenten geriet. Heute liegen HDTV-taugliche Flachbildschirme voll im Trend. Zum Ende 2008 rechnete die Branche mit einem Marktanteil von 30 Prozent.
Was ist HDTV?
Jeder, der sich ein neues Fernsehgerät anschaffen will, wird derzeit mit der Abkürzung HDTV konfrontiert. Was haben diese 4 Buchstaben zu bedeuten?
High Definition Television (HDTV):
HDTV ist ein weltweit digitaler TV-Standard und ein Sammelbegriff, der eine Reihe von Fernsehnormen bezeichnet, die sich gegenüber dem herkömmlichen Fernsehen (Standard Definition Television, SDTV) durch eine erhöhte Auflösung auszeichnen.
Das HDTV-Bild hat schärfere Konturen, eine bessere Farbdarstellung und eine bis zu 5-mal höhere Auflösung als der herkömmliche PAL-Standard. HDTV-Bilder werden digital produziert und übertragen. Das Bildformat wurde generell auf 16:9 festgelegt.
Die HDTV-Ausstrahlungsformate
Im HDTV-Standard sind eine Reihe von Formaten definiert Um sie voneinander zu unterscheiden, werden sie nach Zeilenzahl (720 oder 1080), Anzahl der effektiven Vollbilder pro Sekunde (z.B. 25 oder 50) und Abtastverfahren (i = interlaced / Halbbilder / Zeilensprungverfahren oder p = progressive / Vollbilder) benannt. Aktuell sind Vertikalauflösungen von 720 (Vollbilder) und 1080 Zeilen (Halbbilder) gebräuchlich. Der bisherige Fernsehstandard PAL bietet lediglich 576 sichtbare Zeilen (Halbbildverfahren).
HDTV in der ARD
Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland haben ihren Fahrplan für die Einführung von HDTV bereits fertig gestellt. Das Erste - sowie das ZDF - wird ab der Winterolympiade 2010 in Vancouver zusätzlich zum Standardfernsehen in HDTV übertragen - über Satellit und teilweise im digitalen Kabel.
Noch vor dem Regelbetrieb sind ab Sommer 2009 sogenannte Showcases und Testausstrahlungen zur Leichtathletik-WM, zur IFA in Berlin und während der Weihnachtszeit geplant. Einen HD-Showcase hat EinsFestival bereits zur IFA 2007 und 2008 sowie an Ostern 2008 ausgestrahlt. Zur Weihnachtszeit 2009 wird erneut ein Demonstrationsprogramm gesendet. Seit Juli 2009 strahlt der Kulturkanal arte sein deutschsprachiges Programm zusätzlich in HDTV über den Satelliten ASTRA aus. Wann auch die Dritten Programme als zusätzliche HD-Kanäle gesendet werden, steht noch nicht fest.
Ausstrahlung in 720p/50
Klar ist dagegen, welches Ausstrahlungsformat bei den öffentlich-rechtlichen Sendern angewendet wird. ARD, ZDF, ORF, SRG und arte strahlen ihre HDTV-Kanäle „progressive” mit 720 Zeilen und 50 Vollbildern pro Sekunde gemäß der EBU-Empfehlung aus (720p/50). In HDTV wird es also keine „Halbbilder” mehr geben, sondern nur noch „Vollbilder”, wie man dies heute von hochwertigen Fernseh- und Computerdisplays kennt. Die Zukunft ist noch schärfer: Sie lautet 1080p/50 (Vollbildmodus mit höchster Auflösung 1920 x 1080).
Tipps und Glossar
Wer schon jetzt auf den HDTV-Zug aufspringen will, muss beachten: Anders als technische Neuerungen wie beispielsweise das Farbfernsehen, ist HDTV auf keiner Ebene (Ausstrahlung, Empfänger, Wiedergabegerät) mit dem Standard-Digitalfernsehen SDTV abwärtskompatibel. Das heißt, für den Empfang von HDTV benötigen die Zuschauer Empfangs- und Wiedergabegeräte, die in der Lage sind, HDTV-Signale zu verarbeiten und darzustellen.
Aufpassen beim Shoppen
Beim Kauf von HDTV-Empfangsequipment sollte nicht nur auf den Preis geachtet werden, sondern auch auf die Qualitätssiegel der EICTA (European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology Association):





Das „HD ready”-Logo für Fernsehdisplays und
das „HD TV”-Logo für Receiver (Set-Top-Boxen)
garantieren wichtige Mindestanforderungen
für den Empfang von HDTV.
Beide Logos stehen dafür,
dass die Geräte bestimmte Auflösungen (mindestens 720 Zeilen) und
Eingangsformate (mindestens 720p und 1080i sowie HDCP-codierte Signale)
verarbeiten können.
Displays, die ein „HD ready 1080p”-Logo tragen,
können auch die höchste HDTV-Stufe (1080p) wiedergeben und
erfüllen daher noch weitergehende Kriterien.
Die verschiedenen „Full HD”-Logos,
die häufig Geräte zieren,
sagen hingegen nichts über die Leistungsfähigkeit des Displays aus.
Sie sind lediglich marketingstrategische Bezeichnungen der Hersteller.
Der Pocket-Guide bietet alle wichtigen Infos zum hochauflösenden Fernsehen und hilft bei der Anschaffung eines neuen Fernsehgerätes
Was bedeutet das?
- HDTV
- (High Definition Television) Hochauflösendes Fernsehen
- SDTV
- (Standard Definition Television) Fernsehen in Standardauflösung (PAL: 576 Zeilen)
- HDCP
- (High-bandwith Digital Content Protection) zur Verschlüsselung des HDTV-Signals zwischen Receiver und Display, als Kopierschutz
- HDMI
- (High Definition Multimedia Interface) Schnittstelle zwischen HDTV-Display und Receiver
- DVB-S
- (Digital Video Broadcasting - Satellite) Digitale Übertragungsnorm für Fernsehen und Radio über Satellit
- DVB-S2
- Weiterentwicklung von DVB-S; zeichnet sich durch höhere Bandbreiteneffizienz aus und wird zunehmend für die HDTV-Übertragung eingesetzt
- MPEG 4
- (Moving Picture Experts Group) MPEG-Standard, der u.a. Verfahren zur Video- und Audiokompression beschreibt
Quelle: BR-online
HDTV bei ARD, ZDF, ORF, SRG und arte in bester Qualität
August 2009
Hier ein Info-Blatt des
HDTV bei ARD, ZDF, ORF, SRG und ARTE in bester Qualität
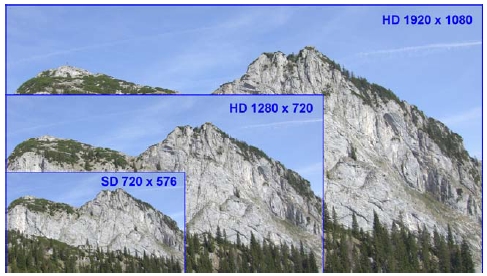
Hybrid-TV
10.09.2009
 Hybrid-TV ist das Fernsehen der Zukunft. Auf der Basis von HTML werden Funktionen und Inhalte aus dem Internet mit dem Fernsehprogramm verknüpft. Das Ergebnis ist ein neues interaktives Fernseherlebnis für den Zuschauer. Über die Farbtasten der Fernbedienung ist die ARD Startleiste aufrufbar, die sämtliche angebotenen Anwendungen übersichtlich präsentiert und miteinander verbindet.
Hybrid-TV ist das Fernsehen der Zukunft. Auf der Basis von HTML werden Funktionen und Inhalte aus dem Internet mit dem Fernsehprogramm verknüpft. Das Ergebnis ist ein neues interaktives Fernseherlebnis für den Zuschauer. Über die Farbtasten der Fernbedienung ist die ARD Startleiste aufrufbar, die sämtliche angebotenen Anwendungen übersichtlich präsentiert und miteinander verbindet.
Die Elektronische Programmvorschau (EPG) kann direkt aus dem laufenden Programm heraus abgerufen werden. Ebenso wird es möglich sein, ein 2. verkleinertes Bild mit einem anderen Fernsehprogramm auf dem Bildschirm aufzurufen. In dieser HTML-Umgebung kann von einer Seite direkt auf ein Fernsehprogramm umgeschaltet oder die Aufzeichnung einer Sendung vorprogrammiert werden. Zusatzinformationen, wie beispielsweise Nachrichtenticker, lassen sich synchron zum Fernsehprogramm einblenden.
Per Fernbedienung können künftig eine die TV-Edition der ARD Mediathek gestartet und einzelne ARD-Sendungen, wie Natur- und Reisedokumentationen, Politik- und Kulturmagazine, Nachrichten- und Bildungssendungen, zeitversetzt abgerufen werden. Grafiken und Abbildungen machen den Teletext der Zukunft anschaulicher und verständlicher. Die neue Fernsehwelt ist nicht nur bunt, sondern vor allem informativ und individuell auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten.
Quelle: ARD
Mobilfunk-Basisstationen: Ohne Festnetz funktioniert auch das Handy nicht
17.09.2009

Basisstation auf Förderturm
Foto: Vodafone
Handys sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Nahezu überall, sogar in der U-Bahn, verbinden die kleinen Mobiltelefone Menschen auf der ganzen Welt miteinander und mittlerweile auch mit dem Internet. Doch nicht alles am Mobilfunk ist mobil. Eine herausragende Rolle für die zuverlässige Kommunikation spielen die so genannten Basisstationen.
Handys sind im eingeschalteten Zustand ständig über Mobilfunk mit der nächst gelegenen Basisstation verbunden. Diese ist in Städten meist nicht mehr als 200 Meter und in ländlichen Regionen mehrere Hundert Meter entfernt. Immer dann, wenn ein Telefonat mit dem Handy geführt oder im Internet gesurft wird, werden die Gespräche oder Daten in Bruchteilen von Sekunden von der Basisstation an das Handy und umgekehrt übermittelt. Die Basisstation selbst ist bei Vodafone mit extrem leistungsstarken Verbindungen an das Festnetz angebunden. Mehrere Hundert Gespräche und Datenverbindungen können so gleichzeitig übertragen werden und erreichen auf diesem Weg den Gesprächspartner. Telefoniert auch der mobil, wird das Gespräch nahezu ohne Zeitverlust vom Handy über die Basisstation von einem Punkt auf der Erde über das Festnetz bis zu der Basisstation an einem anderen Punkt auf der Erde, die dem Gesprächspartner am nächsten ist, und von dort wiederum auf dessen Handy übertragen. Beim Surfen im Internet läuft es fast genauso. Nur, dass hier über die Basisstation Datenpakete vom Handy an einen Server und zurück übertragen werden.
Gesehen hat eine solche Basisstation wohl fast jeder schon einmal. Zu erkennen sind sie an den vielen Antennen, die auf einem Turm montiert beispielsweise an Autobahnen stehen. In Städten sind die Basisstationen häufig nur an Antennenanlagen auf höher gelegenen Hausdächern zu erkennen. Um insbesondere historische Stadtbilder zu erhalten, werden häufig auch Basisstationen so gebaut, dass sie von außen gar nicht als solche zu erkennen sind. Möglich wird das zum Beispiel, wenn die Antennen in der Spitze eines Kirchturms untergebracht werden.
Quelle und Foto: Vodafone D2 GmbH
Mit dem Handy bezahlen: sicher und bequem
02.10.2009
Handys werden immer funktionaler. Mittlerweile ist auch das sichere und bargeldlose Bezahlen mit dem Handy möglich. Kleine Beträge können direkt mit der Mobilfunkrechnung beglichen werden, für größere Summen wird das Lastschriftverfahren einfach per Handy angestoßen.
Mit dem kostenlosen Service „Vodafone Mobiles Bezahlen” können digitale Produkte wie Klingeltöne oder Parktickets bis zu einem Betrag von etwa 10 Euro mit dem Handy bezahlt werden. Durch Übertragung der Mobilfunknummer kann der Kunde schnell und einfach seinen Einkauf via SMS, im WAO oder mobilen Web tätigen. Zusätzlich sichert ein Zahlungscode den Kaufvorgang ab. Nach der Zahlungsbestätigung werden die Beträge mit der Mobilfunkrechnung verrechnet.
Mpass ist ein neues netzübergreifendes Bezahlsystem von Vodafone und O2 für z.B. alle Mobilfunkkunden mit einem deutschen Bankkonto. In Online-Shops wie www.Cinemaxx.de oder www.Blume2000.de können Kinokarten und Blumensträuße mit dem Handy bezahlt werden. Nachdem der Kunde die Zahlungsmethode im Onlineshop ausgewählt hat, stößt er ohne Angabe seiner Kontodaten lediglich mit seiner Mobilfunknummer und selbst gewählter mpass-Pin die Bezahlung an. Um die Zahlung final zu autorisieren, muss er lediglich eine zugesandte Auftrags-SMS zur Freigabe beantworten. Dieser 2-stufige Mechanismus macht mpass besonders sicher. Der Kaufbetrag wird dann per Lastschriftverfahren direkt vom Bankkonto abgebucht. Damit bietet mpass auch die Möglichkeit, größere Beträge zu zahlen.
Videobeispiele für elektronisches Bezahlen finden Sie hier.
Quelle: Vodafone D2 GmbH
Handys und Basisstationen: Was ist der SAR-Wert?
22.10.2009

Im gut ausgebauten Vodafone-Netz
benötigen Handys weniger Sendeleistung -
das hält den SAR-Wert niedrig
Foto: Vodafone D2 GmbH
Beim mobilen Telefonieren senden Handys und Mobilfunkbasisstationen wechselseitig elektromagnetische Felder aus. Diese Felder sind das Transportmittel für die Funksignale, die Informationen zum Teil über mehrere Kilometer vom Sender zum Empfänger übermitteln. Der menschliche Körper kann die Energie der elektromagnetischen Felder absorbieren und in Wärme verwandeln. Dies führt zu einer Temperaturerhöhung von Körpergewebe, die sogenannte thermische Wirkung. Gemessen wird dies mit dem sogenannten SAR-Wert. SAR ist die Abkürzung für die „spezifische Absorptionsrate”. Sie ist die physikalische Größe und das Maß für die Aufnahme von elektromagnetischer Energie in biologischem Gewebe. Der SAR-Wert wird in Watt pro Kilogramm Körpergewicht (Watt/kg) ausgedrückt.
Die elektromagnetischen Felder, die von Basisstationen aus auf den Menschen einwirken, sind dabei in der Regel weitaus geringer als die Felder, die beim mobilen Telefonieren direkt am Ohr erzeugt werden. Grundsätzlich gilt: Je kleiner der SAR-Wert, desto weniger wird das Gewebe erwärmt. Aufgrund der Leistungsregelung haben Handys aber im täglichen Einsatz zumeist einen niedrigen SAR-Wert, da sie in gut ausgebauten Netzen mit einer hohen Dichte von Sendemasten wie zum Beispiel bei Vodafone insgesamt mit einer geringeren Sendeleistung arbeiten. Endgeräte und Basisstationen regeln ihre Sendeleistung automatisch auf das erforderliche Minimum herunter.
Handy-Hersteller messen die SAR-Werte im Labor. Vodafone liefert als Netzbetreiber und Mobilfunkanbieter die Information zum SAR-Wert der Handys bei den technischen Informationen immer mit.
Der SAR-Grenzwert für Felder von Mobilfunkbasisstationen beträgt 0,08 Watt/kg für die allgemeine Bevölkerung. Dieser Wert ist über den gesamten Körper gemittelt. Der Teilkörpergrenzwert für die elektromagnetischen Felder, die beim Gebrauch des Handys in der Höhe des Kopfes entstehen, beträgt 2 Watt/kg. Er ist über 10 g Körpergewebe gemittelt. Diese Grenzwerte stellen sicher, dass die mögliche Temperaturerhöhung des ganzen Körpers in der Nähe von Mobilfunkbasisstationen unter 0,02 °C liegt. Und auch die örtliche Temperaturerhöhung, die beim Gebrauch eines Handys in Teilen des Körpers entsteht, ist geringer als 0,1 °C. Der Teilkörpergrenzwert berücksichtigt zudem den theoretischen Maximalfall. Das bedeutet: Ein Nutzer kann an 7 Tagen pro Woche jeweils 24 Stunden mobil telefonieren, ohne gesundheitlichen Risiken ausgesetzt zu sein. Alle Handys, die Vodafone anbietet, unterschreiten den zulässigen SAR-Wert von 2 W/kg.
Quelle: Vodafone D2 GmbH
Hochleistungscomputer in Miniaturform: Wie sieht ein Smartphone von innen aus?
06.11.2009
E-Mails empfangen und versenden, im Internet surfen, mit Freunden in Verbindung bleiben, soziale Netzwerke nutzen, Musik hören und Filme gucken, Fotos und Videos selbst machen und verschicken oder von Tür zu Tür navigieren - alles Dinge, die noch vor Kurzem nur mit leistungsfähigen Computern möglich waren. Doch dank moderner Smartphones und leistungsstarker Mobilfunknetze ist all dies heute jederzeit und nahezu überall mobil möglich. Von außen betrachtet unterscheiden sich Smartphones kaum von einem herkömmlichen Handy. Doch ihr Inneres gleicht eher einem Hochleistungscomputer, der extrem verkleinert wurde.
Am Beispiel vom BlackBerry Bold, das unter anderem bei Vodafone erhältlich ist, lässt sich gut erkennen, was alles in einem aktuellen Smartphone steckt und wofür es benötigt wird. Neben der „QWERTZ”-Tastatur, die wie bei einem Computer alle Buchstaben nur in kleinerer Form bietet und so das schnelle Schreiben von E-Mails erlaubt, unterscheidet sich ein Smartphone von einem Handy mit herkömmlichen Ziffern insbesondere durch ein großes und hochauflösendes Display, auf dem sich auch gut Filme und Fotos betrachten lassen, die besondere Technik zum Empfangen und Senden von Daten, zum Beispiel um im Internet surfen zu können oder E-Mails zu empfangen sowie durch nachfolgend genannte Features:
Handy-Bauteile BlackBerry Bold

Foto: Vodafone D2 GmbH
| 1 | Audio-Buchse | zum Anschluss des Stereo-Headsets |
| 2 | Micro-USB-Buchse | zum Anschluss des Ladegeräts und zur PC-Synchronisation |
| 3 | Stummschaltung | mit der im Gehäuse integrierten Taste |
| 4 | Kontakt für Lautsprecher | der Lautsprecher selbst ist in der Frontplatte integriert |
| 5 | Tastatur-Kontakte | für die Tasten in der Frontplatte |
| 6 | Mini-Trackball „Pearl” | die Bedienkugel der BlackBerrys |
| 7 | GPS-Empfänger | empfängt Positionsdaten von Satelliten und gibt diese an Navigationsprogramme |
| 8 | Hauptprozessor und Speicher | unter diesem Blech sind „Baseband-Chip” und Arbeitsspeicher montiert |
| 9 | Mini-Rüttelmotor | für den Vibrations-Alarm |
| 10 | Kamera-Modul | Objektiv und Bildverarbeitungssensor für Foto- und Videoaufnahmen |
| 11 | Kontakt für LED-Blitz | er speist den Blitz und löst ihn aus |
| 12 | Bluetooth-Chip und -antenne | für die drahtlose Verbindung beispielsweise von Headsets oder Freisprecheinrichtungen |
| 13 | WLAN-Chip samt Antenne | verbindet das Smartphone drahtlos mit Netzwerken |
| 14 | Stecker für Display-Kabel | Display-Modul (nicht abgebildet) wird hier eingesteckt |
| 15 | Audio-Chips | Chips und Mini-Verstärker für den Ton |
| 16 | SIM-Karten-Halter | er nimmt die Mobilfunk-Karte auf |
| 17 | Steckplatz für Speicherkarte | hier passt eine Micro-SDHC-Karte zur Speichererweiterung hinein |
| 18 | Verstärker für Mobilfunk | Bauteile zur Verstärkung und Antennensteuerung (GSM und UMTS) |
| 19 | Steuerchips für Mobilfunk | Sender und Empfänger für GSM/UMTS |
| 20 | Mikrofon | überträgt die Stimme des Anrufers |
Quelle: Vodafone D2 GmbH
Aus zwei mach eins: Mit Handys überall Musik hören
12.11.2009
Das Handy ist für viele Menschen schon längst eine mobile Jukebox. Heutzutage werden mehr Musikhandys als MP3-Player verkauft. Gründe dafür sind die verbesserte Soundqualität, der größere Speicherplatz, aber auch die signifikante Steigerung der Akkuleistung der Handys. Mobil herunterladbare Musikangebote sorgen zudem dafür, dass nur noch ein Gerät für den Musikgenuss unterwegs genutzt wird.
Über 1 Million Titel umfasst das Musikangebot von Vodafone für grenzenloses Musikvergnügen für unterwegs und daheim. Durch den Verzicht auf digitales Rechte-Management (DRM) kann man die bei Vodafone digital erworbene Musik hören, ohne sich Gedanken zu machen, wo und auf welchem Abspielgerät. Die PC-Software zur Musikverwaltung ergänzt sich spielend mit der mobilen Variante, dem Mobile Music Client. Die günstigen Musik-Pakete runden das Angebot ab. So wird das Kaufen und Hören digitaler Musik in jeder Lebenslage noch einfacher und günstiger.
Über die Kosten für das Musikstück hinaus entstehen beim mobilen Download auf das Handy keine weiteren Übertragungskosten! Voraussetzung hierfür ist die Happy Live Tarif Option, die die meisten Vodafone Vertragskunden haben. Die Abrechnung erfolgt einfach über die Mobilfunkrechnung.
Wenn man mal nicht weiß, was für ein Lied man gerade hört, hilft der MusicFinder. Er ist ein Dienst für Mobiltelefone, der Tracks und Songs erkennt. Für viele Handymodelle gibt es einen Client zur lokalen Installation auf dem Gerät, mit dem der Dienst bequem genutzt werden kann. Man hält das Handy nur kurz in Richtung der Musikquelle und schon wird der Musiktitel angezeigt. Nach erfolgreicher Identifizierung werden bis zu 5 Optionen angeboten, den Track zu erwerben: als Musikstück, Klingelton, Video, Wallpaper (des Künstlers) oder Freizeichenton. Besitzer anderer Telefon-Modelle wählen einfach die 221122 und können die Songs auch ohne Applikation erkennen.
Quelle: Vodafone D2 GmbH
Erste private deutsche GSM-Lizenz wird 20 Jahre alt
04.12.2009
Es war das Top-Thema in den abendlichen Nachrichten vor 20 Jahren: Am 7. Dezember 1989 wurde offiziell die erste private GSM-Lizenz von der Bundesregierung vergeben. Die Lizenz erhielt ein Konsortium unter der Leitung von Mannesmann, dem außerdem Cable&Wireless, die DG Bank und Pacific Telesis angehörten. Die damaligen Mitbewerber um die Lizenz waren allesamt Schwergewichte der deutschen Wirtschaft: Daimler Benz, BMW, MAN und der Axel-Springer-Verlag. Schon 2 1/2 Jahre später, im Sommer 1992, ging das D2-Netz, das erste private Mobilfunknetz, in Betrieb.

Vor 20 Jahren telefonierte man noch mit ziemlich großen Handys / Foto: Vodafone D2 GmbH
Das Standardkürzel „GSM” (Global System for Mobile Telecommunications) wurde zwischen 1991 und 1992 umgewandelt in das Stoßgebet „God Send Mobiles!”. Denn bereits im Juni 1991 begann der Probebetrieb des Netzes in 15 Ballungsgebieten und Anfang 1992 war das D2-Netz vollständig betriebsbereit. Es fehlte nur noch eins: die Mobiltelefone. Im Juni desselben Jahres erhielten die ersten Hersteller von GSM-Mobiltelefonen wie Ericsson und Motorola die europaweite Zulassung für ihre Prototypen und Ende Juni 1992 wurden die ersten 1.000 kommerziellen Mobiltelefone geliefert und fanden umgehend reißenden Absatz.
Die ersten D2-Telefone kosteten 2.500 DM bis 3.000 DM. Allerdings war das zur damaligen Zeit ein sensationell niedriger Preis, denn aus dem C-Netz musste man noch rund 10.000 DM für Autotelefone auf den Tisch legen. Das Mobiltelefon war bis zu dem Zeitpunkt noch identisch mit dem Autotelefon und angesichts der Einstiegspreise und der hohen monatlichen „Grundgebühren” im C-Netz ein Luxusgut nur für gut betuchte Kreise. Die große Vision zum Netzstart bestand darin, mobiles Telefonieren für breite Bevölkerungsmassen erschwinglich zu machen. So kostete beispielsweise vor 20 Jahren eine Mobilfunkminute während des Tages 1,44 DM bei einer Monatsgrundgebühr von 77,52 DM. In der Nebenzeit, also zwischen 19 und 7 Uhr, nur noch 49 Pfennige. Heute ist eine Mobilfunkminute mit dem Prepaid-Handy schon ab 5 Cent zu haben und Vieltelefonierer stellen sich ihre Flatrates ganz nach Bedarf ab 4,95 Euro im Monat zusammen.
Bereits im August 1996, 4 Jahre früher als geplant, wurde der 2.000.000 Mobilfunkkunde begrüßt. Nur weitere 2 Jahre später betrug die Zahl der Mobilfunkkunden bereits knapp 14 Millionen. Im 2. Quartal 2009 meldete die Bundesnetzagentur 107 Millionen Teilnehmer. So gesehen gibt es in Deutschland inzwischen mehr Handys als Einwohner.
Quelle: Vodafone D2 GmbH
Erste E-Mail in Deutschland 2. August 1984 / Erste De-Mail 8. Oktober 2009
02.08.1984/08.10.2009
Mit viel Optimismus wurde Anfang der 1990er Jahre in Dortmund und Karlsruhe das kommerzielle Internet in Deutschland eingeläutet. Beide Projekte EUnet (in Dortmund) und XLINK in Karlsruhe sind heute nicht mehr zu finden. Es bleibt die Erinnerung an den Internet-Provider XLINK, der am 1. November 1993 den Sprung aus der Universität Karlsruhe in die freie Wirtschaft gewagt hat.
Aber auch vor der Ausgründung gab es schon XLINK, und dort wurden bereits 1984 die ersten E-Mails per Internet mit USA ausgetauscht. Die erste offizielle elektronische Nachricht an einen eigenen deutschen Mailserver erreichte am 2. August 1984 aus USA Deutschland, eine neue Ära beginnt. Absender war Laura Breeden vom Computer Science Network (CSNET), einem Netz für Forschung und Hochschulen in den USA mit internationalen Anbindungen. Empfänger waren Prof. Michael Rotert, damals Technischer Leiter des Rechenzentrums der Informatik der Universität Karlsruhe, und Prof. Werner Zorn, damals Professor für Informatik an der Uni Karlsruhe. Beide arbeiteten schon seit Jahren intensiv an Entwicklung und Aufbau eines elektronischen Nachrichtensystems.
Am 1. Mai 2000 verschwand mit dem Umbennen in KPNQwest der Name XLINK. Am 19. August 2002 kam es zur Eröffnung der Insolvenz, nachdem KPNQwest in Europa in sich zusammenfiel. Die E-Mail hatte längst ihren Siegeszug angetreten.
Prof. Werner Zorn hat für eine Ausstellung in Karlsruhe 2004 zahlreiche Dokumente als „Meilensteine” des hindernisreichen Weges von 1982 bis 1993, bis zur XLINK-Ausgründung am 10. Dezember 1993, zusammengestellt. Mit seiner freundlichen Genehmigung sind einige dieser Dokumente hier abgebildet:
1. eigene Mailbox der Uni Karlsruhe bei University College London (ULC)
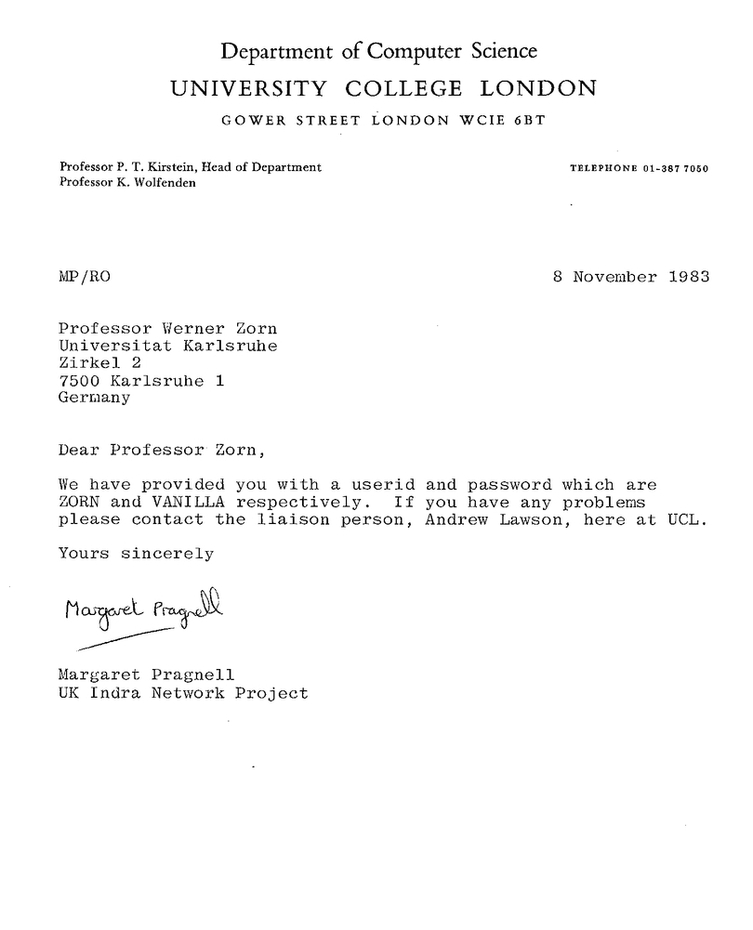
28. Februar 1984: 1. direkter E-Mail-Kontakt mit CSNET (Laura Breeden)
8. März 1984: „General Information”
1. Mail von Prof. Larry Landweber, Univ. Madison, Wisconsin
16. April 1984: Vertrag mit CSNET
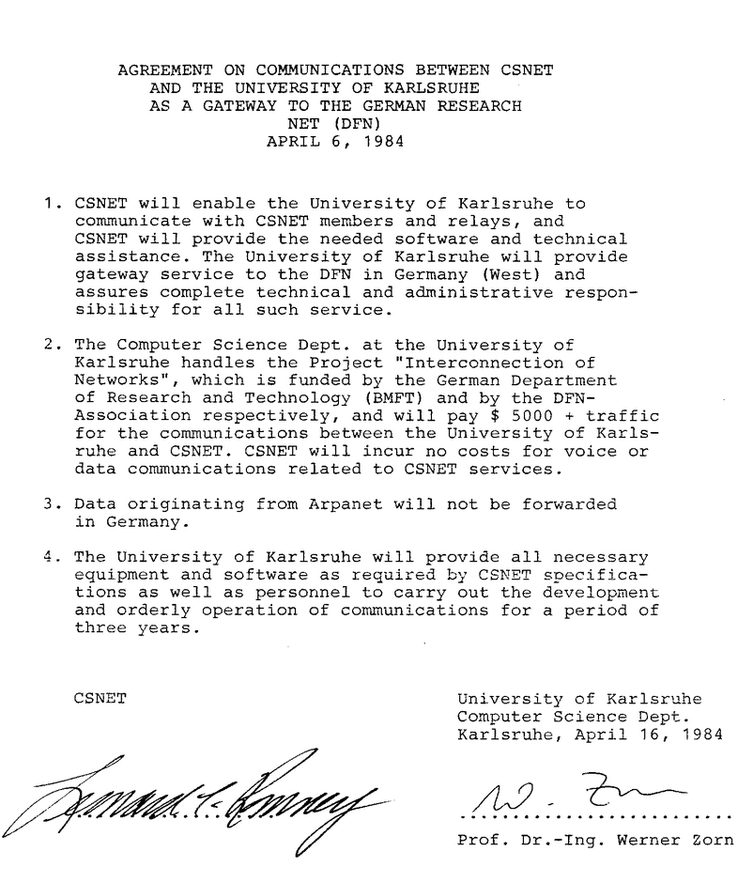
16. April 1984: Mail von Prof. Larry Landweber/Dick Edmiston, CSNET CIC „Approval to proceed...”
23. Juli 1984: Pressemitteilung Prof. Werner Zorn, Uni Karlsruhe:
CSNET-HOST an der Informatik Karlsruhe funktionsbereit
16. Juli 1985: Schreiben Prof. Zorn an Staatsministerium Baden-Württemberg: Vorschlag China-Kopplung
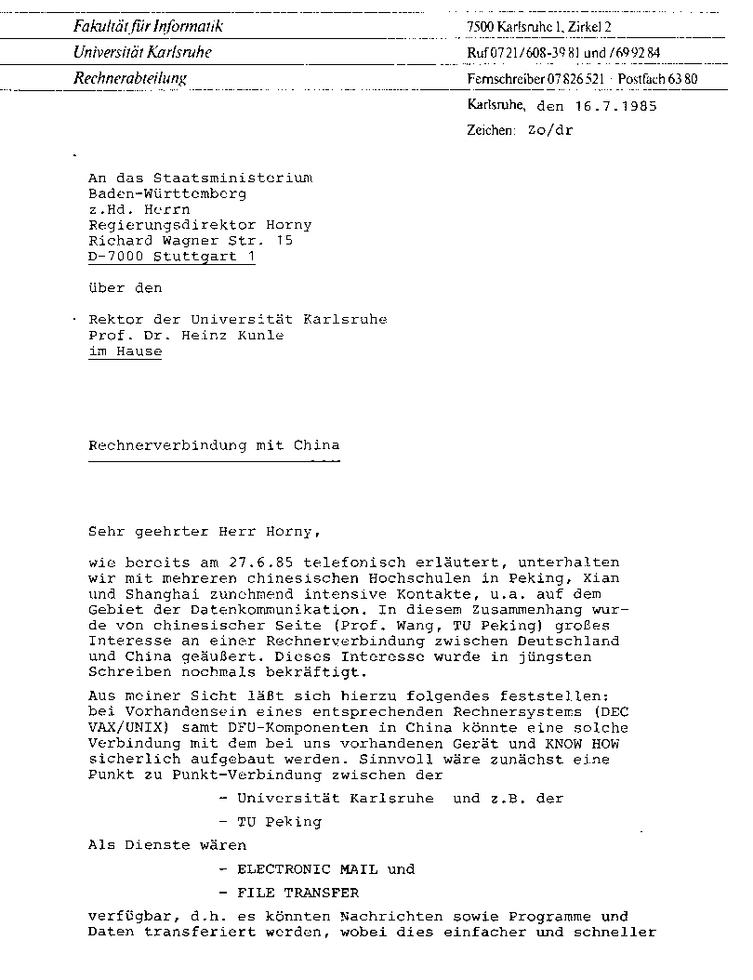
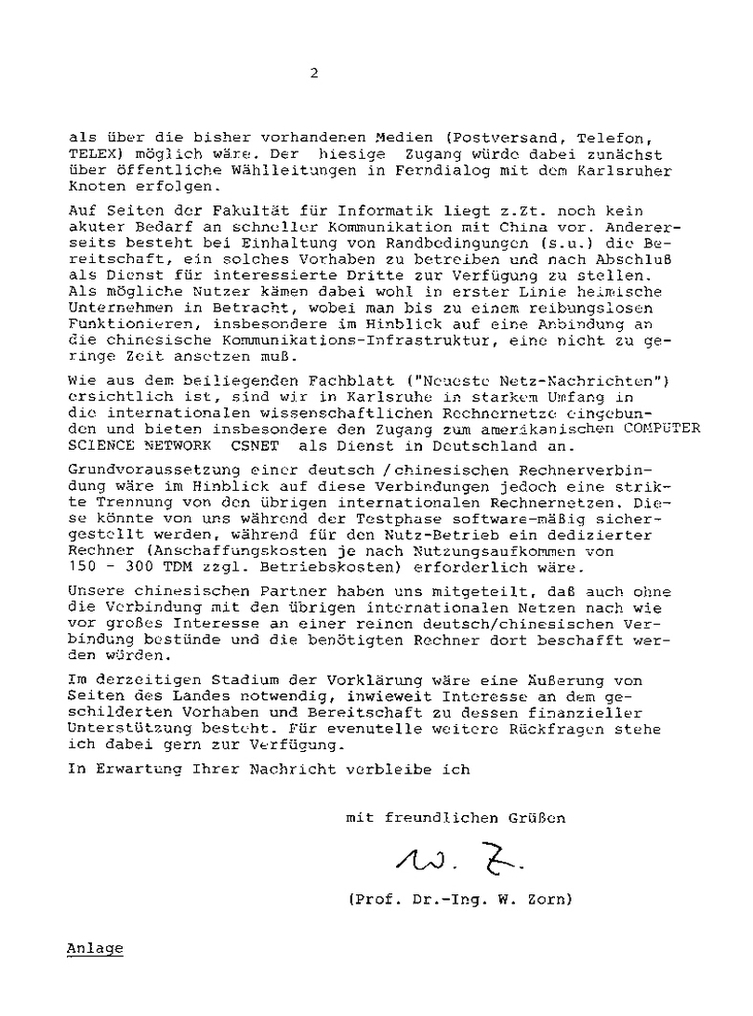
27. November 1985: Zusage China-Kopplung
Zusammenarbeit der Universität Karlsruhe mit China auf dem Gebiet der Datenkommunikation
(Erlass Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg vom 15.11.1985 UU 081.84-Ka/32)
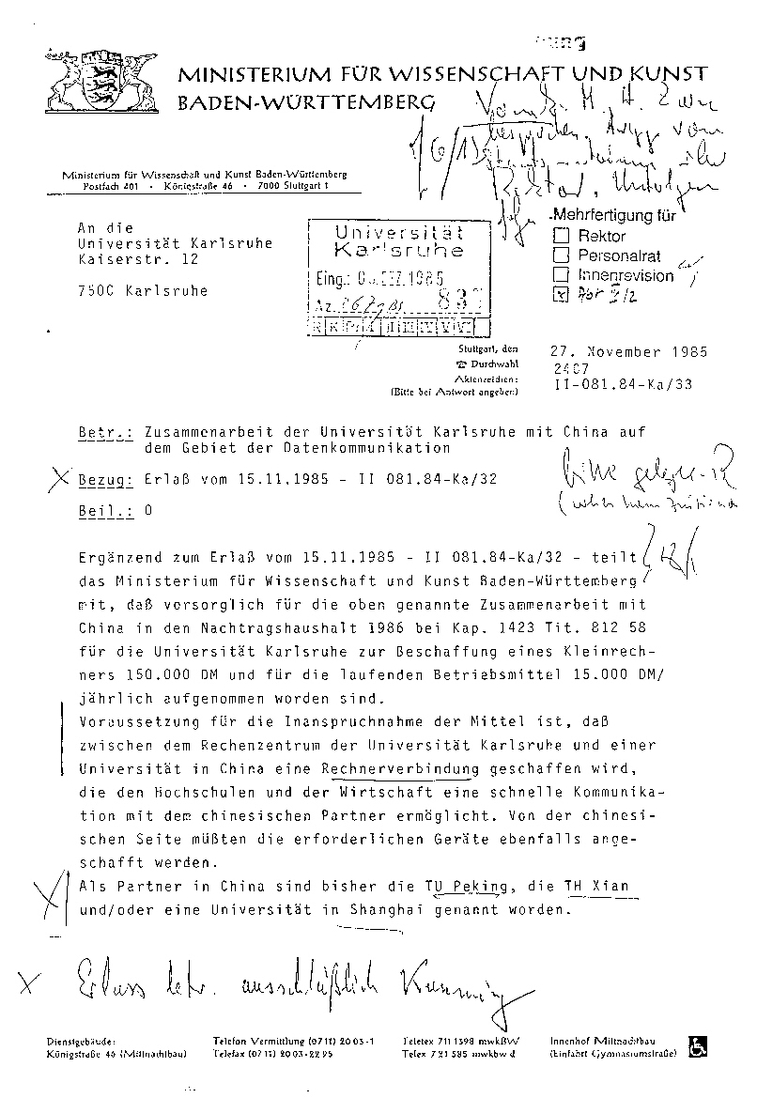
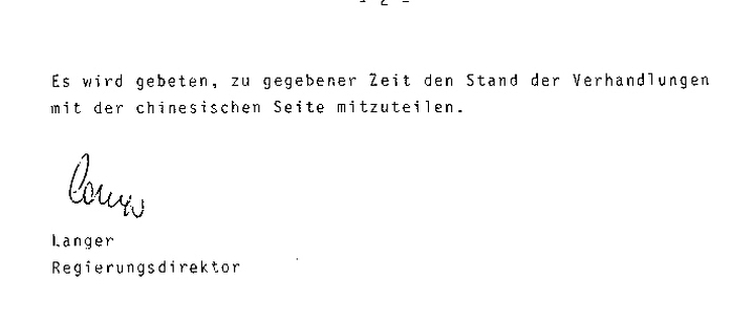
3. März 1986: Abschrift aus
Heft 3 der „NNN- Neueste Netznachrichten” mit dem Leitartikel
„Quo vadis- DFN?”
>
28. August 1986: Pressemitteilung der Uni Karlsruhe:
1. Dialogverbindung Deutschland - China (Datex-P/X.25)
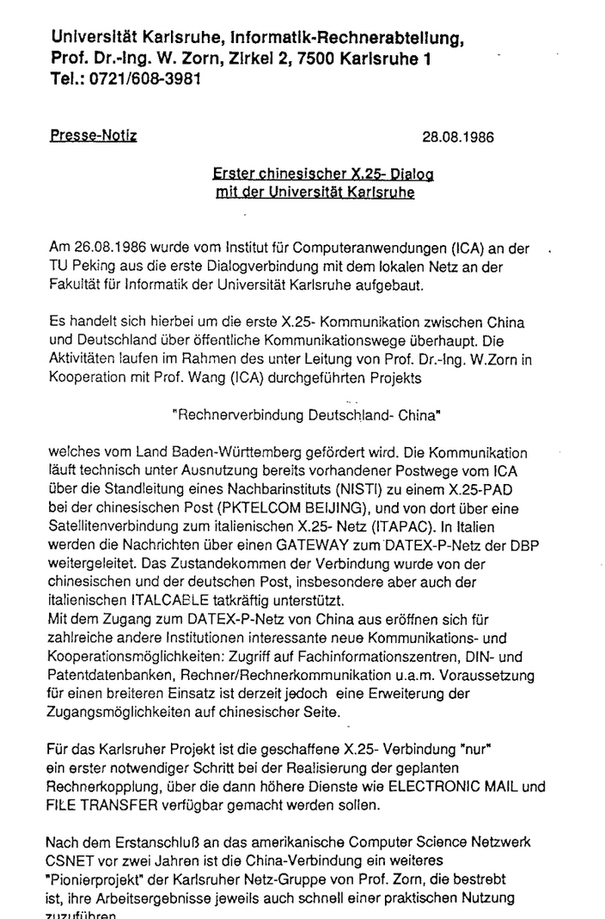
Computerwoche 37/1986:
„X.25-Dialog zwischen Deutschland und China”
TU Peking und Universität Karlsruhe nutzen Datex-P und Satelliten

20. September 1987:
Weltweit erste offene Email-Verbindung Chinas mit Deutschland
„Across the Great Wall...”
28. November 1987:
NSF approvement
Offizielle Anerkennung der China E-Mail-Verbindung durch die US National Science Foundation
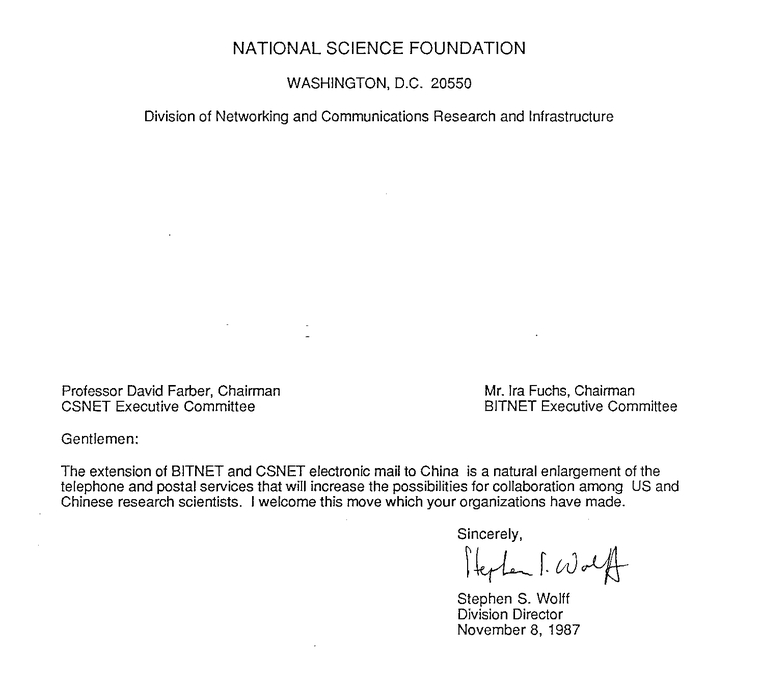
BelWü entsteht als TCP/IP-Insel
BelWü Baden-Württemberg erweitertes Nahbereichsnetz
Stand Februar 1988
Verbund zwischen Freiburg, Heidelberg, Hohenheim, Karlsruhe, Konstanz, Mannheim, Stuttgart, Tübingen und Ulm
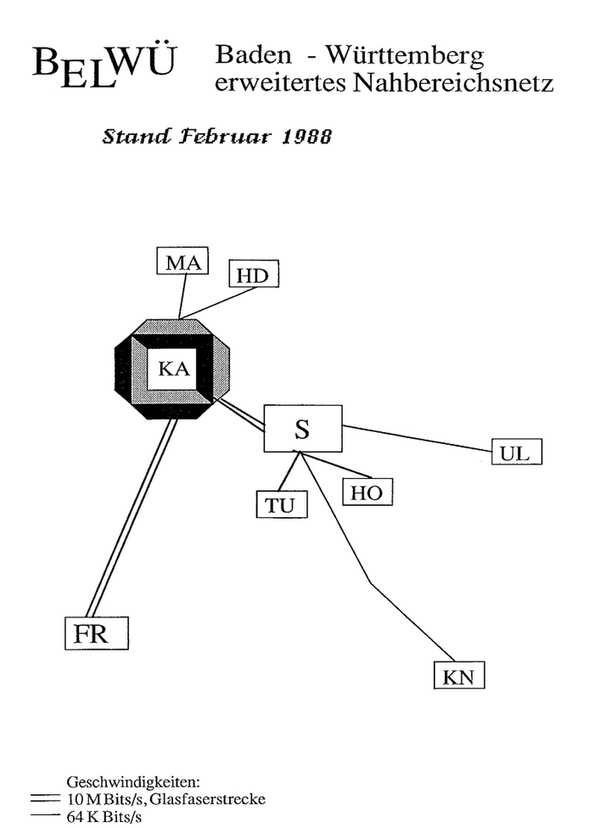
Karlsruher CSNET-Relay wächst zur nationalen und internationalen Drehscheibe
CSNET- Relay Verbund, Januar 1988
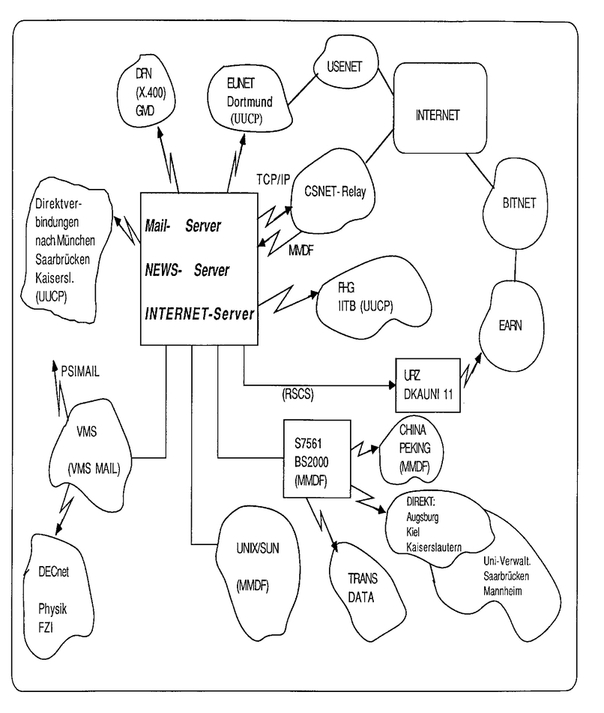
Erste „Blüte” des Hacker-Wesens in Karlsruhe
Clifford Stoll „Stalking a Wily Hacker”, 1988
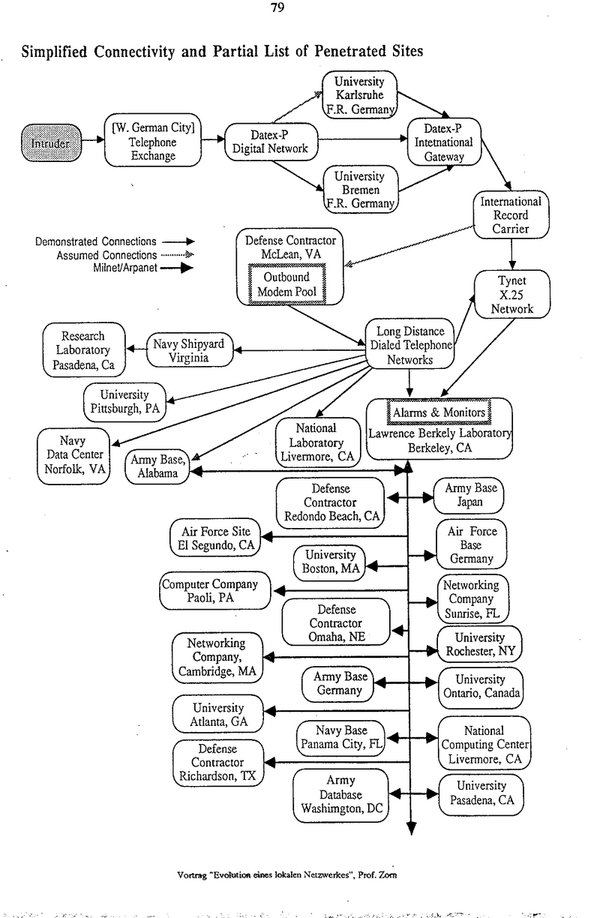
Informatik Karlsruhe realisiert INTERNET-Anschluss
Pressemitteilung Mai 1988
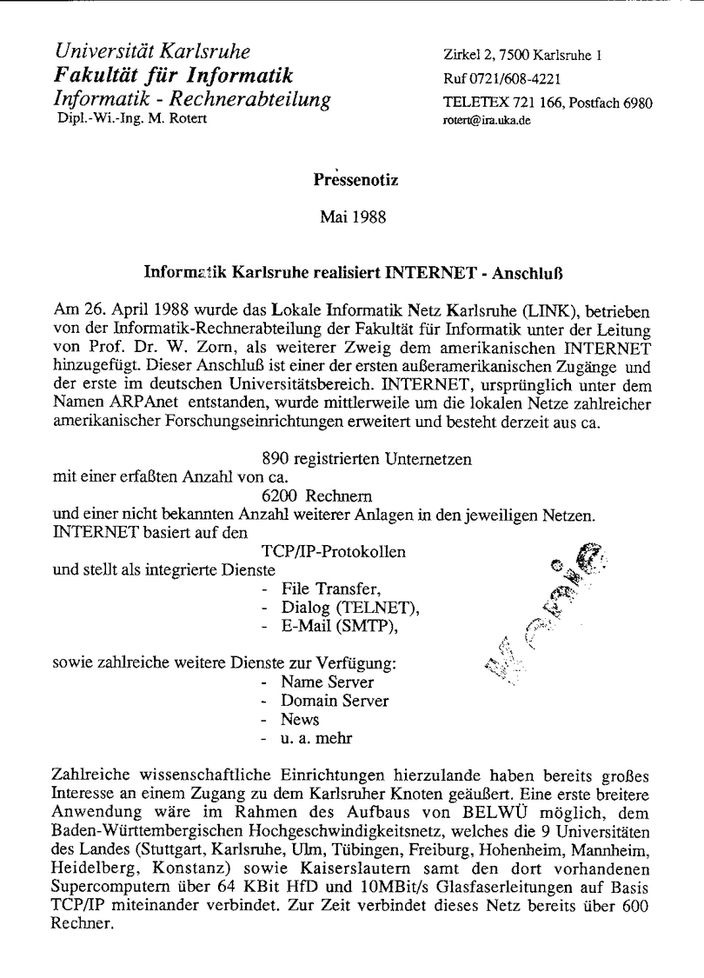
23. Januar 1989:
VASCOM-Angebot über eine 9.6 kbps-Leitung von Karlsruhe nach New York
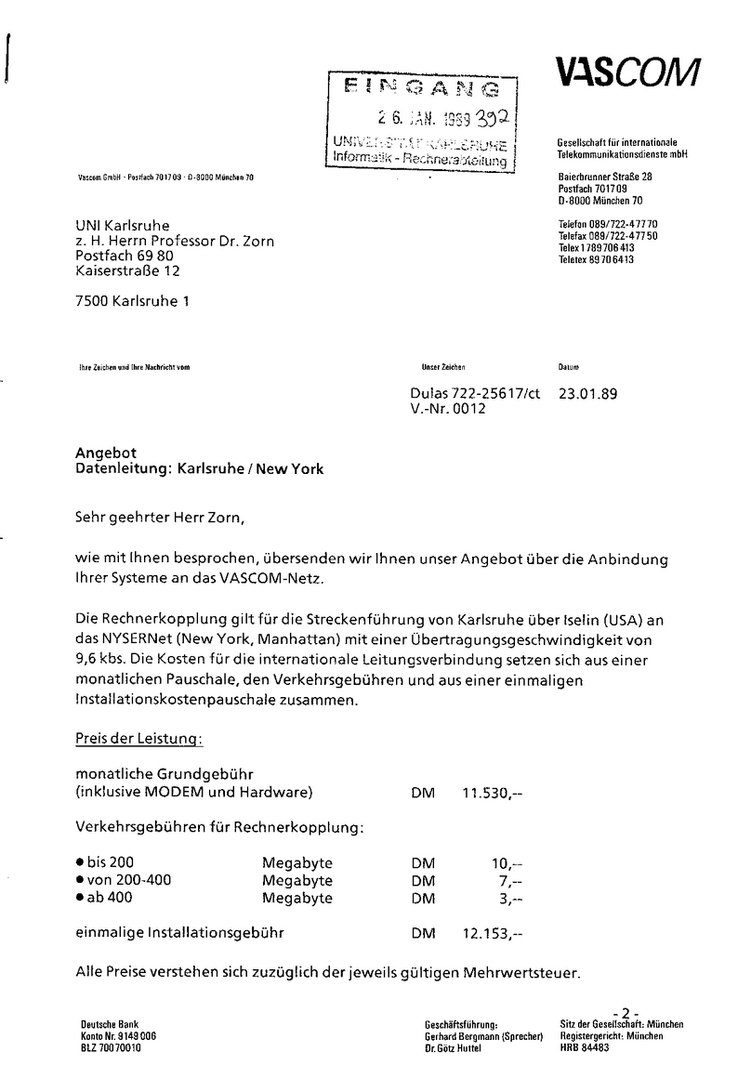
6. Februar 1989:
Xlink-Angebot an MWK/BelWue über Internet-Anschluss
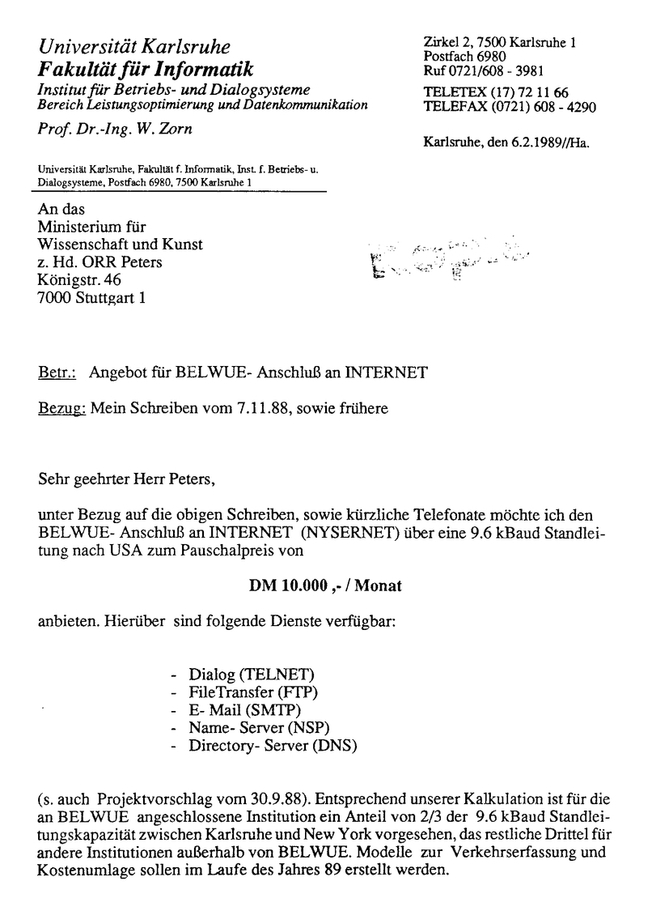
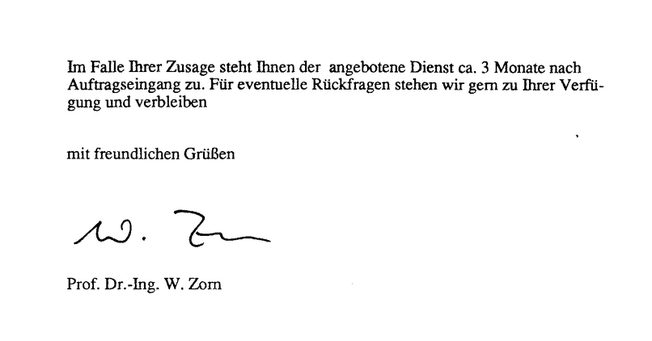
23. Januar 1989:
Zugang des Landes Baden-Württemberg zum NSFNET
Auftrag des MWK an Xlink
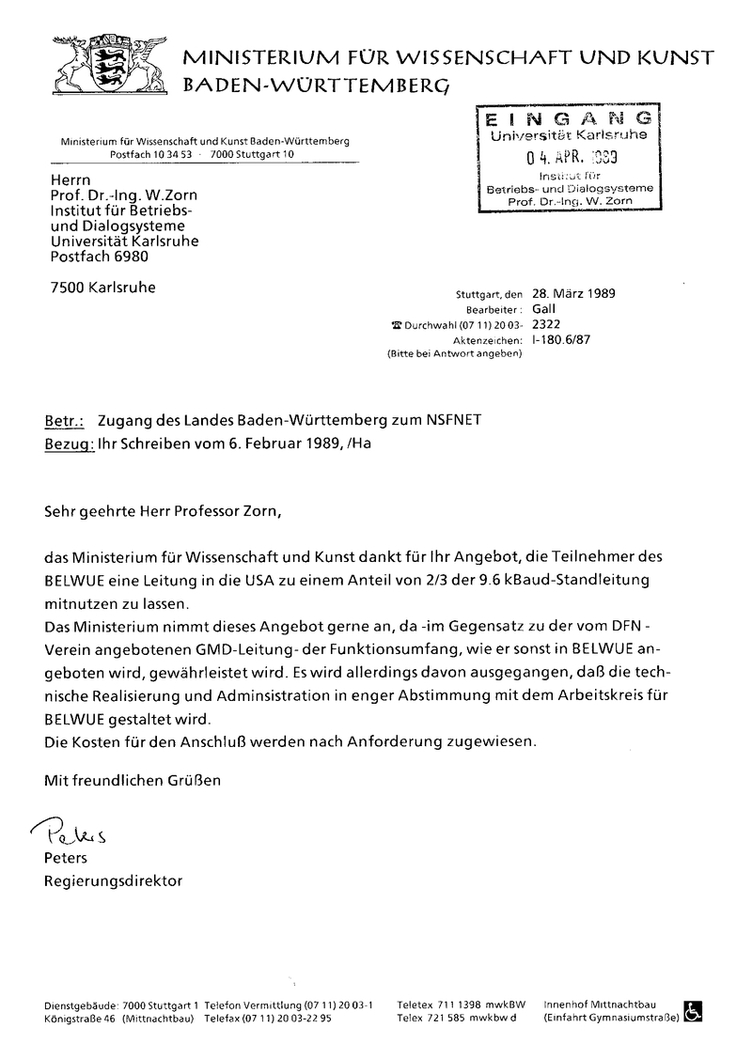
Herzlichen Dank an
Prof. Dr. Ing. Werner Zorn
für die Bereitstellung dieser historischen Dokumente und seine Zustimmmung zur Aufnahme in diese Dokumentation.
Newsletter 1/1990: Vielen Dank an Yasar Arman für die Überlassung des Scans dieses Zeitdokuments:
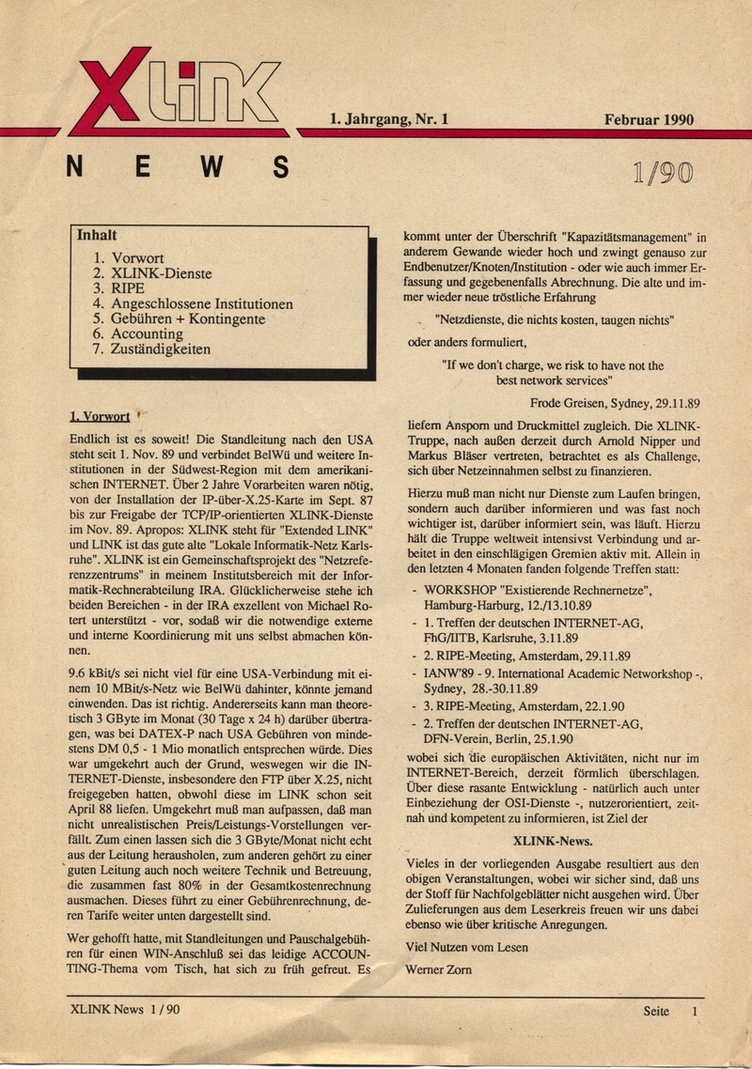
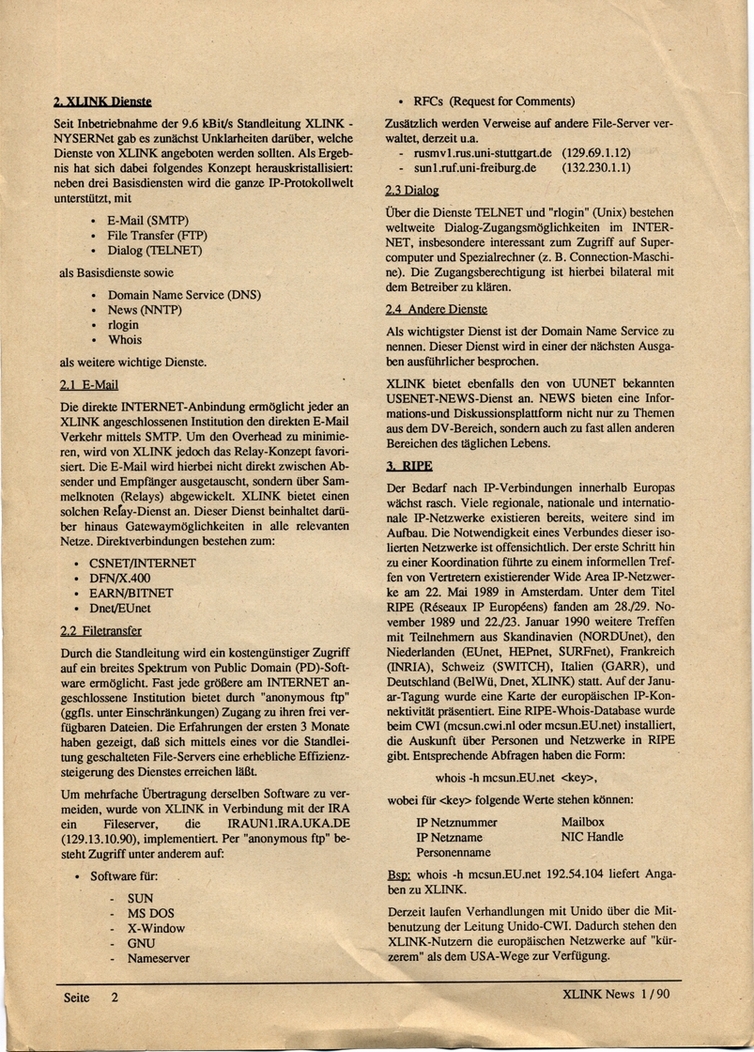
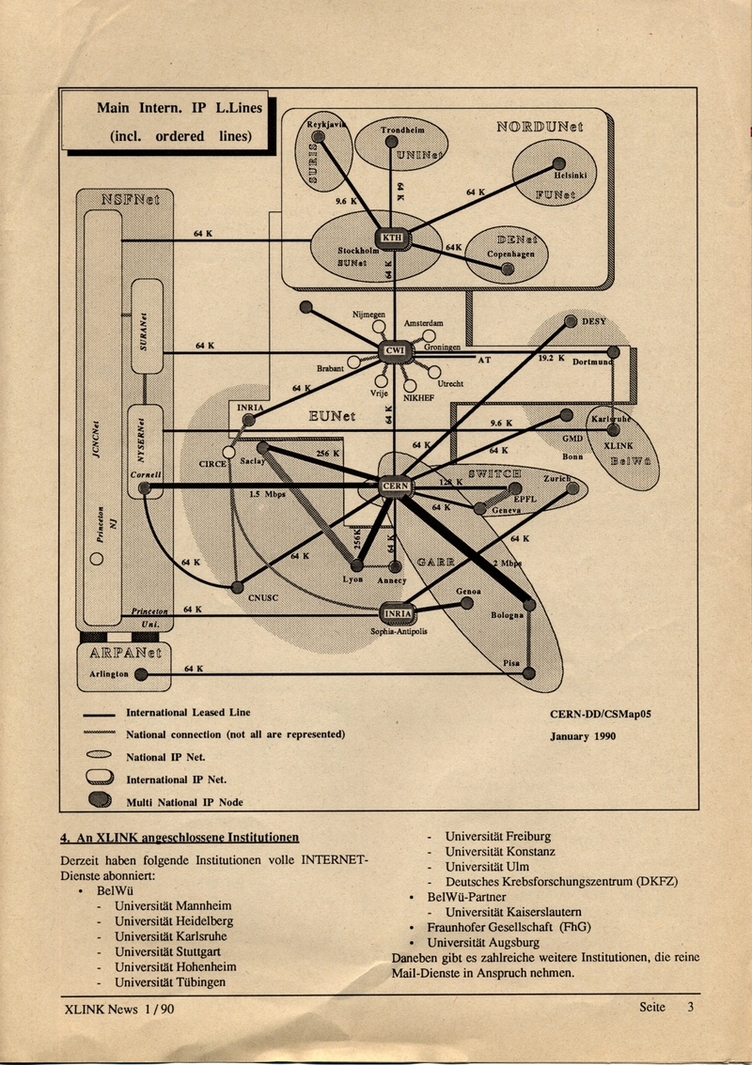
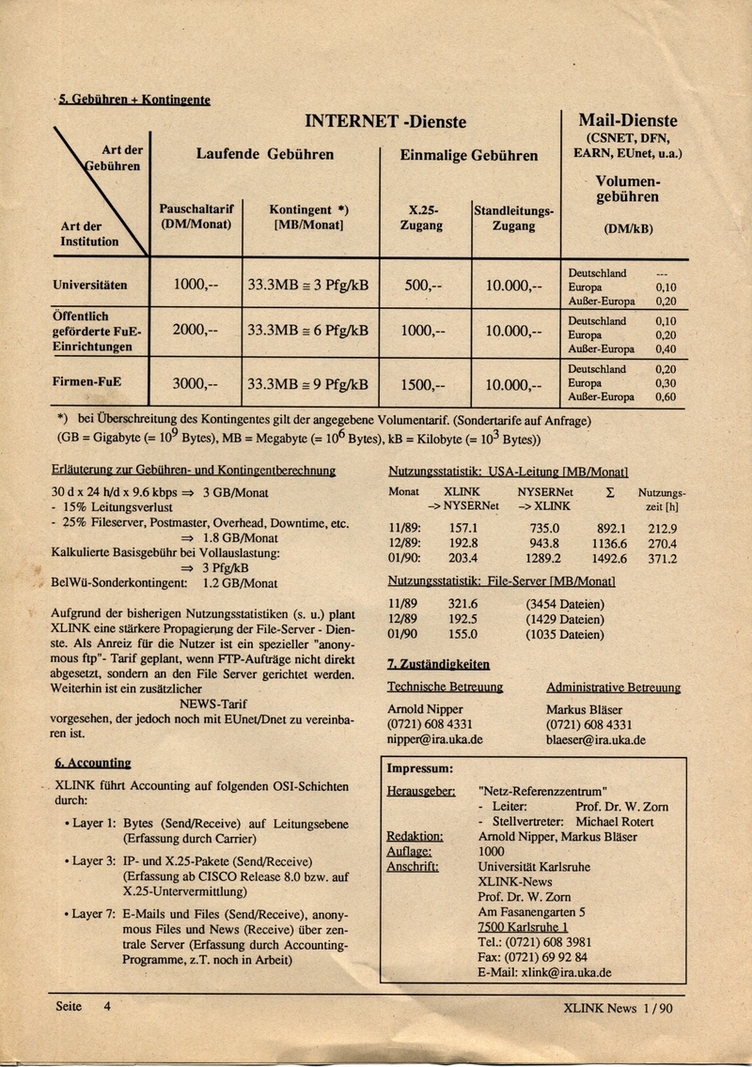
8. Oktober 2009: Erste De-Mail verschickt
25 Jahre nachdem Prof. Werner Zorn, einer der Gründerväter des deutschen Internet, die erste E-Mail empfing, die jemals an ein deutsches Postfach geschickt wurde, hat ihm Dr. Bernhard Rohleder vom Hightech-Verband BITKOM am 8. Oktober 2009 die erste De-Mail geschickt.
Dr. Hans Bernhard Beus, Staatssekretär im Bundesministerium des Innern und Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik, erläuterte im Anschluss an diese Premiere: „De-Mail ist eine Weiterentwicklung der ‚einfachen’ E-Mail wie wir sie heute alle kennen. Die Weiterentwicklung besteht darin, dass Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen und auch die Verwaltung mit De-Mail eine einfach zu nutzende Technologie an die Hand bekommen, mit der sie sicher, rechtsverbindlich und vertraulich im Internet miteinander kommunizieren können. Geschäftliche Angelegenheiten oder Behördenkommunikation, für die bisher der Postweg oder sogar persönliches Erscheinen nötig waren, können mit De-Mail einfacher, schneller und von jedem Ort aus vollständig elektronisch erledigt werden. De-Mail ist damit so einfach wie die E-Mail und so sicher wie die Papierpost.”
Die 1. offizielle De-Mail wurde versandt auf einer Pressekonferenz des Bundesinnenministeriums in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund anlässlich der am nächsten Tag beginnenden 6-monatigen Pilotierung von De-Mail in Friedrichshafen. Ab Ende 2010 soll De-Mail bundesweit eingeführt werden.
Die erste versandte De-Mail im Wortlaut:
Betreffzeile: Erste De-Mail in Deutschland
Sehr geehrter, lieber Herr Prof. Zorn,
vor 25 Jahren haben Sie die erste E-Mail in Deutschland empfangen. Schon damals war klar, dass die E-Mail eine einzigartige Erfolgsgeschichte schreiben wird. Ein Vierteljahrhundert später machen wir einen weiteren großen Schritt, und Sie sind wieder an der Premiere beteiligt: Heute erhalten Sie die erste De-Mail in Deutschland.
Ich bin der festen Überzeugung, dass sich die De-Mail ebenso durchsetzen wird wie die bekannte E-Mail. De-Mails sind vertraulich wie ein persönlich überreichter Brief und komfortabel wie ein Mausklick. Die De-Mail wird E-Government und E-Commerce so richtig in Schwung bringen.
Herzliche Grüße
Bernhard Rohleder
Die Antwort auf die erste versandte De-Mail:
Betreffzeile: Vertrauen ist gut, De-Mail ist besser!
Sehr geehrter Herr Dr. Rohleder,
herzlichen Dank für die erste De-Mail. Mit zunehmender rechtlicher Relevanz der Kommunikation über das offene Internet stellt dieser neue Dienst einen großen Schritt nach vorn dar, über den ich mich schon zu meiner Zeit an der Uni Karlsruhe gefreut hätte.
Ich wünsche dem Projekt eine große Akzeptanz und seinen Förderern und Anbietern viel Erfolg!
Ihr Prof. Werner Zorn
Quelle für den De-Mail-Vorgang: Bundesinnenministerium und Prof. Werner Zorn
Apps im Alltag: Fit und schlank mit dem Handy
18.02.2010
Applikationen, abgekürzt Apps, sind aktuell ein heiß diskutierter Trend - für Anbieter und Nutzer. Die kleinen Serviceprogramme lädt man kostenfrei oder gegen Entgelt aus einem Onlineshop direkt aufs Handy. Sie sind für den Alltag als Helfer in allen Lebenslagen konzipiert, so auch beim Thema Frühlingsdiät. Sie begleitet alljährlich die Fastenzeit nach Karneval.
Gesunde Ernährung und viel Bewegung sind die Empfehlungen hinter allen Diät- und Fitnesstipps. Beim Ernährungsmanagement oder beim Erfassen und Auswerten von Aktivitäten helfen Apps zielsicher. Bei „Barcoo” und bei „Das ist drin” scannt einfach die Handykamera den Barcode von Lebensmitteln. Aus Datenbanken steuern dann die Zucker- und Fettwerte, Anteile der gesättigten Fettsäuren und des Natriums aufs Display. Eine Lebensmittel-Ampel vermittelt einen ersten Überblick. Eine besonders innovative App, die Vodafone ausgezeichnet hat. Noch sind zwar nicht sämtliche Marktwaren erfasst, doch jeder Nutzer kann Werte ergänzen - so wächst auch der Datenbestand. Beim „DietMaster”, „Diet Coach” oder „Diets” füttert man seine eigene Datenbank mit persönlichen Werten. Über die Details der Mahlzeiten lassen sich die Kalorien errechnen und eine Ernährungsgraphik erstellen. Bei „Diets” wird die Kalorienzahl direkt Bewegungswerten gegenübergestellt.
Neben Ernährungstabellen gibt es vor allem aus der Sport-Ecke eine Vielzahl von Apps, die kostenfrei oder kostenpflichtig passend unterschiedliche Elemente kombinieren. „Buddy Runner” oder „Cardio Trainer” zeigen die eigene Jogging-Strecke während des Trainings auf einer Karte, ermitteln Distanz, Geschwindigkeit und Kalorienverbrauch. Mit diesen Grundlagen lassen sich ausgeklügelte und ganz persönliche Fitnessprogramme entwickeln.
Die App-Welten sind mit einer Vielzahl von Lösungen bestückt. Wie und ob man sie nutzt, ist so individuell wie das eigene Handy. Doch es geht auch anders: Fürs Fasten bietet die Katholische Kirche ein ausgefallenes Angebot: die Fasten SMS. Bis Ostern unterbricht eine SMS mit einem Bibelspruch den Tagesablauf - zum Nachdenken und Innehalten. Details erläutert die Website www.kirche.tv. Die Aktion hat bereits eine Fanseite auf Facebook unter dem Titel „SMS-Fasten”. Und für den Zugriff auf Facebook gibt es natürlich gleichfalls Apps - oder sogar weitergehende Vernetzungsmöglichkeiten, etwa auf dem neuen Vodafone 360.
Quelle: Vodafone
Über 10 Millionen E-Mails im Monat
07.01.2010
Ob geschäftlich oder privat: die „Electronic Mail” eroberte am Ende der 1. Dekade des neuen Jahrtausends die Pole-Position bei der Internetnutzung im Privathaushalt. Das belegen die Erhebungen des Statistischen Bundesamtes in der Studie „Informationsgesellschaft in Deutschland 2009”. Unzählige E-Mails rasen heute rund um den Globus - als Botschaft aus dem privaten Bereich und natürlich auch als Geschäftspost. Alleine an Vodafone Deutschland werden monatlich mehr als 10 Millionen E-Mails adressiert. Und die elektronische Post hat Zukunft: mehr und mehr wird sie auch unterwegs über mobile Endgeräte wie Smartphones genutzt.
Als vor 25 Jahren, im August 1984, die erste elektronische Post Deutschland erreichte, ahnte niemand, dass diese Technik unsere Kommunikationswelt nachhaltig verändern würde. Empfänger war Michael Rotert, damals Technischer Leiter der Informatikrechnerabteilung an der Universität Karlsruhe (TH). Laura Breeden in Cambridge (Massachusetts) hatte ihm eine Grußnachricht vom Computer Science Network (CSNET) gesendet *). Eine Kopie dieser Mail ging zeitgleich an Prof. Werner Zorn, Uni Karlsruhe. Die Übermittlung hatte mehrere Stunden gedauert.
Heute rasen E-Mails in Sekunden um den Globus. Von den monatlich über 10 Millionen E-Mails an Vodafone in Deutschland ist ein Großteil Spam - unerwünschte Werbung, schlimmstenfalls mit Viren verseuchte Post. Überwachungssysteme filtern diese penibel aus. Lediglich 1,8 Millionen E-Mails finden schließlich den Weg auf die Bürobildschirme der Vodafone-Angestellten. Rechnet man dies auf die Gesamtzahl der Vodafone Mitarbeiter in Deutschland hoch, vom Pförtner bis zur Geschäftsleitung, erhält jeder durchschnittlich 6 E-Mails pro Arbeitstag - ausschließlich von Adressaten außerhalb des Unternehmens. Hinzu kommen hausinterne Mitteilungen und E-Mails aus dem weltweiten Konzern an die deutschen Kollegen. Gemeinsam übersteigen sie das Aufkommen der exter-nen Zusendungen um ein Vielfaches.
Auch im privaten Bereich hat sich die elektronische Post durchgesetzt: Laut Branchenverband BITKOM versenden heute 85 Prozent aller Internetnutzer ab 14 Jahre private Mails, das sind knapp 43 Millionen Bundesbürger. Über die Hälfte der bundesdeutschen Internetnutzer kontrolliert täglich das persönliche elektronische Postfach. Zunehmend werden dabei auch mobile Geräte genutzt, sogenannte Smartphones. Die praktischen Helfer erlauben über Mobilfunkverbindungen fast überall den E-Mail-Empfang und -Versand. Und selbst auf den kleinen Tastaturen eines Smartphones lassen sich schnell formvollendete Nachrichten tippen. Ein kleiner Kniff hilft dabei: In den Autotext-Funktionen (meist erreichbar im Menü Einstellungen) hinterlegt man einfach persönliche Grußformeln als Buchstabenkombinationen. Ein „mfg” wandelt das Smartphone dann automatisch zum „Mit freundlichen Grüßen”, ein „thx” zum „herzlichen Dank”, ein „lg” zu „mit lieben Grüßen” und mit „sw” wünscht man ganz freundlich ein „schönes Wochenende„.
Quelle: Vodafone
*) Die erste E-Mail in Deutschland erhielt am 3. August 1984 Prof. Michael Rotert, damals Technischer Leiter der Informatikrechnerabteilung an der Universität Karlsruhe (TH). Ein Kopie ging - wie das Original-Dokument beweist - an Prof. Werner Zorn, damals ebenfalls Uni Karlsruhe.
Das Dokument stellte freundlicherweise Prof. Werner Zorn zur Verfügung. An ihn ging auch die erste De-Mail. Sie wurde am 8. Oktober 2009 im Rahmen der Pressekonferenz in Berlin verschickt, bei der Staatssekretär Hans Bernhard Beus, Bundesinnenministerium, das Projekt De-Mail in Friedrichshafen startete. Absender der De-Mail war Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer des Hightech-Verbands BITKOM. Der Text der De-Mail und die Antwort von Prof. Zorn darauf: Siehe http://www.post-und-telekommunikation.de/Tk_2009_4_Okt-Dez.php
Einzelheiten und Dokumente rund um die Geschichte der E-Mail siehe Stichwort „Erste E-Mail in Deutschland 1984”
Die Frequenz
15.04.2010

Frequenzen: Die Mobilfunkfrequenz überträgt
Musik aufs Handy, die Tonfrequenz lässt sie uns hören und
mit dem richtigen Song
steigt dann sogar die Herzfrequenz.
Foto: Vodafone
Folgt man dem lateinischen Wortursprung frequentia, bedeutet Frequenz schlicht und einfach Häufigkeit. In unserem modernen Sprachgebrauch ist dieser Begriff eine physikalische Größe und konzentriert sich auf die Häufigkeit eines sich wiederholenden Vorgangs. Gemessen wird die Frequenz mit der Maßeinheit Hertz (kurz Hz - nach dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz), die in den meisten Fällen die Anzahl der Schwingungen innerhalb einer Minute angibt.
Es gibt unterschiedliche Frequenzen, zum Beispiel die Herzfrequenz, Tonfrequenz, Umlauffrequenz oder Radiofrequenz. Folgt man der modernen Wortbedeutung lässt sich die Frequenz auf viele Alltagssituationen übertragen: Wie oft schaue ich täglich auf mein Mobiltelefon - selbst das lässt sich als wiederholender Vorgang als Frequenz abbilden, auch wenn er keine Schwingungen verursacht - zumindest bei den meisten.
Apropos Mobiltelefon - im Bereich der beiden Mobilfunknetze in Deutschland (das D-Netz und das E-Netz) werden Frequenzbänder in den Bereichen 900 MHz und 1800 MHz verwendet. Bei den UMTS-Funknetzen, mit denen man über das Mobiltelefon im Internet surfen kann, liegt die Hertz-Größe etwas höher: der Bereich ab 2100 MHz (das sind 2.100 Millionen Schwingungen pro Sekunde!) wird fast überall auf der Welt genutzt. In Nordamerika verwenden die Netze übrigens überwiegend das 1900 MHz Band.
Genauer betrachtet sind Frequenzbänder keine wirklichen Bänder, sondern Teilbereiche der elektromagnetischen Wellen, die zur technischen Kommunikation benötigt werden. Frequenzbereiche, die bislang in Deutschland für Radio- und TV-Übertragungen genutzt worden sind, stehen übrigens künftig für mobile Lösungen zur Verfügung. Diese Frequenzen wurden frei, als der bislang analoge Rundfunk digitalisiert wurde, denn die digitale Übertragung benötigt weniger Frequenzbreite als die analoge. Die deutschen Mobilfunkanbieter ersteigerten diese freien Bereiche im April/Mai 2010 bei der Bundesnetzagentur. Versteigert wurden dabei auch die wichtigen Frequenzen bei 800 MHz. Aufgrund der relativ geringen Hertz-Größe sind die Wellen länger und haben eine größere Reichweite. Ein Vorteil, denn damit kann man schnelles Internet über Funk in ländliche Regionen bringen, die bislang keinen festen Internet-Anschluss hatten.
Quelle: Vodafone D2 Deutschland GmbH
Weltfernmeldetag
14.05.2010
Das Internet hat die Chance, Basis für eine globale Wissensgesellschaft zu werden. Unter diesem Gesichtspunkt begehen die Vereinten Nationen jährlich am 17. Mai den Weltfernmeldetag. Grundlage für die Teilnahme an den neuen Kommunikations- und Wissensmedien ist in allen Ländern die Infrastruktur. Telekommunikationsunternehmen wie Vodafone sind hierbei in einer Schlüsselrolle.
Rund 4,6 Milliarden Mobilfunkteilnehmer weltweit hat der Internationale Telekommunikationsverband (ITU) für das Jahr 2010 errechnet - in der Statistik entspricht das etwa 67 Prozent der Weltbevölkerung. Rund 1,7 Milliarden Menschen haben einen Internetzugang. Der Zahlenwert lohnt eine genauere Betrachtung: Während in den Industrienationen über 3 Fünftel der Bevölkerung einen Internetanschluss haben, sind es laut ITU in Entwicklungsländern kaum 1 Fünftel. Oder anders formuliert: 4 von 5 Menschen fehlt in solchen Ländern jeglicher Zugang zum globalen Informationsmedium, zur Wissensgesellschaft.
Was dies heißt, zeigt das Beispiel Ghana. Seit fast genau einem Jahr ist der Kommunikationskonzern Vodafone hier tätig. 2009 besaß lediglich jeder 3. Ghanaer ein Handy. Und nur rund 5 Prozent der Einwohner hatten einen eigenen Internetanschluss, so die ITU. Es fehlte schlichtweg an Infrastruktur. Seit Dezember 2009 hat Vodafone über 300 Millionen US-Dollar in das Telekommunikationssystem des afrikanischen Staates investiert. Zum 1. Mai 2010 hat Ghana nun den internationalen Standard des Vorwahl- und Rufnummernsystems einführen können. Standards, wie sie für wirtschaftliche Entwicklungen mit entscheidend sind. Es entstehen die Grundlagen, die nötig sind, damit viele Ghanaer künftig an der globalen Wissensgesellschaft teilnehmen können.
Quelle: Vodafone D2 Deutschland GmbH
Zugang: Mit Hochgeschwindigkeit auch ohne Kabel ins Web
24.06.2010

Auf der Deutschlandkarte ist zu sehen,
wo mit Internet über Funk die weißen Flecken beseitigt werden.
Foto: Vodafone
Dem drahtlosen Internetzugang über Funk gehört die Zukunft. Nach der Versteigerung der Frequenzen im April/Mai 2010 bei der Bundesnetzagentur ist der Weg frei für eine effiziente Versorgung aller Menschen in ganz Deutschland mit schnellem Internet. Ein großer Vorteil des drahtlosen Zugangs zur Infrastruktur des 21. Jahrhunderts: bislang notwendige aufwendige und langwierige Erdarbeiten sind nicht mehr nötig und der komplizierte Zugang über das Kupferkabel bis zum Haus, die sogenannte letzte Meile, entfällt. Denn das schnelle Internet kommt ganz ohne Kabel aufs Land und in die Stadt. Dabei ist mobiles Internet genauso schnell, sicher und leistungsstark, wie Kabelanschlüsse.
Wie leistungsfähig Mobilfunknetze wie etwa das von Vodafone Deutschland sind, belegt eindrucksvoll die Zahl von 22 Millionen Gigabyte, die allein im letzten Jahr an Daten mit Note- und Netbooks sowie Smartphones per Funk von Vodafone-Kunden mobil übertragen wurden. Diese Daten eng auf A4-Papier gedruckt, ergeben einen Turm von 5,5 Milliarden Seiten, der 550 km in die Höhe ragt. Der Kölner Dom passt 3.500 Mal aufeinander gestapelt in einen Turm dieser Höhe.
Schon heute sind über Mobilfunk Geschwindigkeiten von mehr als 10 Mbit/s zu erreichen. Einen kompletten Song lädt man damit in weniger als 5 Sekunden herunter, einen ganzen Spielfilm in ca. 20 Minuten. Mit LTE wird sich das noch einmal deutlich beschleunigen, selbst aufwendige Webseiten sind dann schon in dem Moment auf dem Bildschirm zu sehen, in dem die Adresse eingetippt wurde.
Um das möglich zu machen, hat Vodafone Deutschland in den letzten 10 Jahren durchschnittlich bis zu 2 Milliarden Euro pro Jahr aus eigenen Mitteln in seine Netze und in diesem Jahr 1,43 Milliarden Euro in neue Funkfrequenzen investiert. Dank höherer Effizienz und neuer Netzstruktur auf Basis des Internet-Protokolls werden mit LTE die Kosten pro übertragenes Megabyte nicht steigen.
Quelle: Vodafone D2 Deutschland GmbH
Das Wohnzimmer wird zum 3D-Kino / Auftakt der Eishockey-WM am 7. Mai 2010 in 3D
06.05.2010
3-dimensionale Bilder halten Einzug in die Wohnzimmer. Das Eröffnungsspiel der Eishockey-WM wird in Deutschland am 7. Mai 2010 über Internet-TV in 3D gezeigt. An einigen öffentlichen Plätzen werden auch Spiele der Fußball-WM in Südafrika in 3D übertragen. Über Satellit ist bereits ein 3D-Demokanal empfangbar. Ab Juni 2010 erscheinen erste Blu-ray-Filme in 3D. „Das Heimkino der Zukunft ist 3-dimensional - der Zuschauer erhält den Eindruck, Teil des Geschehens zu sein”, sagte BITKOM-Vizepräsident Achim Berg. Der BITKOM erklärt, welche Geräte für den Einstieg ins heimische 3D-Kino nötig sind und wie sie funktionieren.
1. 3D-Bildschirm
Zunächst wird ein 3D-fähiger Bildschirm benötigt. Dies kann ein spezieller Flachbildfernseher oder PC-Monitor sein. Die Geräte werden von den Herstellern entsprechend gekennzeichnet. Fast alle großen Markenhersteller haben solche Geräte angekündigt. Ein Nachrüsten von Displays älterer Bauart ist in aller Regel nicht möglich.
Die aktuellen 3D-Displays arbeiten mit dem sogenannten stereoskopischen Verfahren. Dabei wird abwechselnd jeweils für ein Auge ein Bild dargestellt, während das andere Auge dank einer speziellen Brille verdeckt bleibt. So entsteht im Gehirn ein 3-dimensionales Bild. Für ein flimmerfreies Bild benötigt jedes Auge eine Bildfrequenz von mindestens 60 Hz. Durch das abwechselnde Abdunkeln halbiert sich die verfügbare Frequenz für jedes Auge. Daher muss der Bildschirm das gesamte Bild mit einer Frequenz von mindestens 120 Hz anzeigen. 3D-fähige Fernseher können auch das normale Programm in 2D ohne Qualitätseinbußen wiedergeben.
Für den Empfang der 3D-Fernsehbilder ist ein HD-tauglicher Receiver oder eine HD-taugliche Set-Top-Box nötig.
2. 3D-Shutterbrille
Um den 3D-Effekt wahrnehmen zu können, wird zusätzlich zum 3D-fähigen Display eine sogenannte aktive Shutterbrille benötigt. Wichtig: Brillen und Displays müssen zwingend aufeinander abgestimmt sein. Man sollte sie am besten gleich beim TV-Kauf erwerben. 3D-Shutterbrillen für das Heimkino arbeiten mit einem anderen Verfahren als die bekannten 3D-Brillen im Kino. Die Kino-Brillen können daher für das 3D-Heimkino nicht benutzt werden.
3. 3D-Blu-ray-Laufwerk
Anfang Juni 2010 wird der erste Blu-ray-Film in 3D veröffentlicht. Die Einführung von DVD in 3D ist nicht geplant, dafür reichen Bildqualität und Speicherkapazität der DVD nicht aus. Für die Wiedergabe von 3D-Filmen wird ein spezieller Blu-ray-Player benötigt, der die neue Technologie unterstützt. Ein Teil der Spielekonsolen hat ein Blu-ray-Laufwerk integriert und kann mit einem Update 3D-Filme zeigen.
4. 3D-Filme und -Spiele
Auch die Inhalte müssen natürlich in 3D produziert worden sein. Animierte Filme gibt es bereits überwiegend in 3D. Das Animationsstudio Pixar („Toy Story”, „Ice Age”) hat angekündigt, künftig ausschließlich 3D-Filme produzieren zu wollen. Reale Filmszenen müssen dagegen immer mit 2 Kameras aufgenommen werden, daher ist ihre Produktion aufwendiger. Doch auch solche Filme wird es vermehrt in 3D geben. Computerspiele werden seit Ende der 1990er Jahre fast ausschließlich in 3D produziert. Daher gibt es hier schon heute ein breites Angebot.
Quelle BITKOM
1 Jahr öffentlich-rechtliches Fernsehen in HD-Qualität - Tipps für den Einstieg ins hochauflösende Fernsehen
11.02.2011
- Jeder 3. Haushalt für HD-Empfang ausgerüstet
- 30 Millionen Flat-TVs und 4,7 Millionen Set-Top-Boxen verkauft
- Tipps für den Einstieg in die HD-Fernsehwelt
Vor genau einem Jahr begann im Deutschen Fernsehen ein neues Zeitalter. ARD und ZDF starteten am 12. Februar 2010 bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver den Regelbetrieb mit hochauflösenden Übertragungen. Die Bildschärfe der HDTV-Bilder ist bis zu 5-mal höher als bisher. „Der Regelbetrieb der öffentlich-rechtlichen Sender in HD hat dem hochauflösenden Fernsehen den Durchbruch ermöglicht”, sagte BITKOM-Präsident Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer. 2010 wurden nach Angaben des Marktforschungsinstituts EITO 9,6 Millionen Flachbildfernseher in Deutschland verkauft. Für dieses Jahr wird ein Rekordabsatz von 9,8 Millionen Geräten erwartet. Seit Einführung der ersten HD-fähigen Flachbildfernseher wurden knapp 30 Millionen Geräte verkauft. „Hochauflösendes Fernsehen hat in Rekordzeit die deutschen Wohnzimmer erobert. HDTV kann schon von 1 Drittel der 40 Millionen Haushalte geschaut werden”, so Scheer.
 Allerdings fehlen vielen Verbrauchern noch Informationen, wie sie auf ihrem Flachbildfernseher auch wirklich HD-Bilder sehen können. „Viele Zuschauer meinen, dass sie mit einem ‚HD-ready-Gerät’ automatisch Fernsehsendungen in HD-Qualität schauen”, sagte Scheer. Für den Empfang hochauflösender TV-Bilder wird jedoch zusätzlich ein spezieller HD-Receiver benötigt, der in älteren Flachbildgeräten nur selten integriert ist. Aktuelle Modelle hingegen werden meist mit einem eingebauten Receiver ausgeliefert, der den Empfang von HD-Signalen über Kabel oder Satellit ermöglicht. Rund 19 Millionen der verkauften 30 Millionen Flachbildfernseher verfügen nicht über einen integrierten Receiver. Alle HD-ready-Fernseher können zudem mit einer Set-Top-Box für den Empfang hochauflösender Fernsehbilder nachgerüstet werden. Nach Angaben der GfK Konsumforschung sind in den vergangenen Jahren 4,7 Millionen dieser HD-fähigen Set-Top-Boxen verkauft worden.
Allerdings fehlen vielen Verbrauchern noch Informationen, wie sie auf ihrem Flachbildfernseher auch wirklich HD-Bilder sehen können. „Viele Zuschauer meinen, dass sie mit einem ‚HD-ready-Gerät’ automatisch Fernsehsendungen in HD-Qualität schauen”, sagte Scheer. Für den Empfang hochauflösender TV-Bilder wird jedoch zusätzlich ein spezieller HD-Receiver benötigt, der in älteren Flachbildgeräten nur selten integriert ist. Aktuelle Modelle hingegen werden meist mit einem eingebauten Receiver ausgeliefert, der den Empfang von HD-Signalen über Kabel oder Satellit ermöglicht. Rund 19 Millionen der verkauften 30 Millionen Flachbildfernseher verfügen nicht über einen integrierten Receiver. Alle HD-ready-Fernseher können zudem mit einer Set-Top-Box für den Empfang hochauflösender Fernsehbilder nachgerüstet werden. Nach Angaben der GfK Konsumforschung sind in den vergangenen Jahren 4,7 Millionen dieser HD-fähigen Set-Top-Boxen verkauft worden.
Der BITKOM gibt Tipps, wie der Einstieg in die hochauflösende Fernsehwelt funktioniert:
- Welche Geräte können HD-Bilder anzeigen?
Wer Fernsehen in HD-Qualität schauen möchte, braucht einen Flachbildfernseher oder Beamer, der das 2005 eingeführte „HD ready”-Logo trägt. Das Logo garantiert, dass der Bildschirm mindestens eine Auflösung von 720 Zeilen hat und über einen digitalen Eingang verfügt. Röhrenfernseher können keine hochauflösenden Bilder darstellen und empfangen. - Welche Zusatzgeräte werden für den Empfang von HDTV benötigt?
TV-Geräte mit einem HD-ready-Logo können hochauflösende Bilder darstellen. Allerdings ist nicht zwingend auch ein HD-tauglicher Empfänger eingebaut. In jedem Fall kann der HD-ready-Fernseher für HD-Empfang mit dem Kauf einer Set-Top-Box nachgerüstet werden. Diese Box wird dann über ein sogenanntes HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. - Auf welchem Empfangsweg kann man Fernsehen in HD empfangen?
Die HD-Signale sind ausschließlich über digitale Verbreitungswege in HD zu sehen, also über einen digitalen Kabelanschluss, digitalen Satellit oder über sogenanntes IPTV, also Fernsehen über das Internet. Beim Kabel gibt es bei der Signalübertragung je nach Anbieter regionale Unterschiede, über die man sich im Fachhandel informieren kann. Beim digitalen Antennenfernsehen DVB-T ist eine Übertragung der HD-Signale derzeit nicht möglich. Wichtig ist zudem die Auswahl des richtigen Programms: Die TV-Sender übertragen parallel in der Standardauflösung und in HD. Viele Zuschauer vergessen jedoch, auf den HD-Kanal umzuschalten. - Sind auch bei neuen TV-Geräten Zusatzboxen erforderlich?
Kunden sollten beim Neukauf eines Fernsehers auf jeden Fall wissen, ob ihr TV-Signal per Kabel, Satellit, Antenne oder Internet in die Wohnung kommt. Je nach Empfangsweg der TV-Signale brauchen Zuschauer andere Geräte für den HD-Empfang. Die meisten aller neuen TV-Modelle werden derzeit mit eingebautem HD-Kabeltuner verkauft. Mit diesem können zumindest unverschlüsselte Signale empfangen werden, wie sie ARD und ZDF ausstrahlen. Wer HDTV über Satellit empfängt, braucht einen HD-tauglichen Satellitentuner. In einigen modernen TV-Geräten sind auch schon HD-Tuner für mehrere Empfangswege integriert, etwa Kabel und Satellit. Bei IPTV ist immer eine Zusatzbox erforderlich, die in der Regel auch als Videorekorder dient. - Was ist zu tun, wenn die Signale per Kabel oder Satellit verschlüsselt sind?
Privatsender wie ProSieben, Sat1, Kabel1, RTL, Vox oder Sky verschlüsseln ihre HD-Signale. Hier brauchen Kunden spezielle Set-Top-Boxen oder TV-Geräte mit Schnittstellen für sogenannte CI-Module, mit denen die Signale entschlüsselt werden können. Dazu sollte man sich im Fachhandel beraten lassen. Bei IPTV übernimmt die Entschlüsselung häufig die vom Anbieter ausgelieferte Set-Top-Box ohne weiteres Zutun des Kunden. - Wo gibt es zusätzlich zum TV weitere Inhalte in HD-Qualität?
Video-Downloads und -Streams in HD über das Internet sind bereits möglich, etwa beim Apple iTunes Store in Verbindung mit Apple TV oder bei Maxdome Videoload sowie YouTube. Zudem können Blu-ray-Player, Spielekonsolen sowie moderne Digitalkameras und Camcorder Bilder in HD liefern.
Nähere Informationen gibt es im kostenlosen „Leitfaden zum hochauflösenden Fernsehen der Zukunft (HDTV)” unter www.bitkom.org/de/themen/54914_54439.aspx und hier.
Hinweis zur Datenquelle: Das European Information Technology Observatory (www.eito.com) liefert aktuelle Marktdaten zu den weltweiten Märkten der Informationstechnologie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. EITO ist ein Projekt der Bitkom Research GmbH. Das EITO arbeitet mit den Marktforschungsinstituten PAC, IDATE, IDC und GfK zusammen.
Quelle BITKOM
150 Jahre Telefon - Meilensteine: Vom Hebdrehwähler bis zum Smartphone
07.09.2011
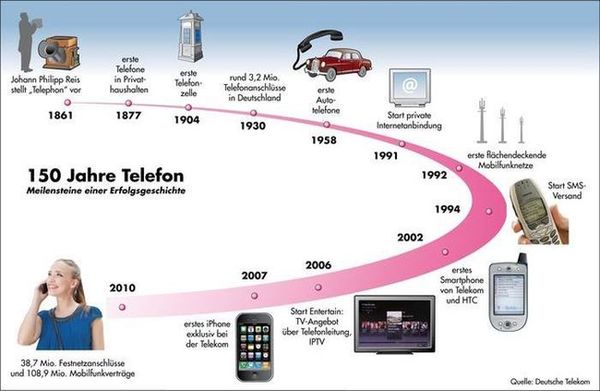
- 1861: Am 26. Oktober stellt Johann Philipp Reis sein „Telephon” erstmals der Öffentlichkeit vor.
- 1876: Alexander Graham Bell meldet sein Telefon, eine Weiterentwicklung des Reis'schen „Telephons”, zum Patent an.
- 1877: In Deutschland wird das erste Gespräch mit einem Bell-Apparat geführt. Noch im selben Jahr produziert die Firma Siemens & Halske die ersten Telefone.
- 1881: Die ersten öffentlichen Telefonnetze entstehen, unter anderem in Berlin. Damit nimmt auch die erste Fernsprechvermittlungsstelle ihren Betrieb auf: Das Fräulein vom Amt wird zum neuen Berufsbild.
- 1889: In den USA wird der Hebdrehwähler erfunden und damit die technische Grundlage für die automatische Gesprächsvermittlung.
- 1904: Die erste Telefonzelle wird von Wilhelm Quante in Wuppertal gebaut, aber nicht im Bergischen Land, sondern in Berlin aufgestellt.
- 1908: In Hildesheim nimmt die erste automatische Vermittlungsstelle ihren Dienst auf.
- 1926: Die Reichsbahn führt auf der Strecke Hamburg-Berlin in allen D-Zügen die „Zug-Telefonie per Funk” ein.
- 1930: In Deutschland gibt es rund 3,2 Millionen Telefonanschlüsse.
- 1936: Gemeinschaftsanschlüsse für „Wenigsprecher” werden eingeführt.
- 1939-1945: Während der ersten Kriegsjahre wird das Telefonnetz in Deutschland zunächst weiter ausgebaut. Im weiteren Verlauf kommt der private Telefonverkehr mehr und mehr zum Erliegen.
- 1955: Mitte der 1950er Jahre beginnt der Ausbau der Selbstwählferndienste. Schon bald können Telefonbesitzer darüber auch ins Ausland telefonieren.
- 1958: Mit dem A-Netz nimmt das erste großflächige Mobilfunknetz in Deutschland seinen Betrieb auf. Genutzt wird es überwiegend über Autotelefone. Die Geräte wiegen ca. 16 Kilo und sind so groß, dass sie fast den kompletten Kofferraum eines Pkws ausfüllen.
- 1969: Mit dem militärisch und wissenschaftlich genutzten Netzwerk ARPANET entsteht der Vorläufer des Internets.
- 1972: Das B-Netz kommt: Man kann nun auch im Auto angerufen werden. Aber nur, wenn der Aufenthaltsbereich (Vorwahl) des Fahrzeuges bekannt ist. Die Geräte sind nun etwa so groß wie ein Koffer.
- 1977: Die Deutsche Bundespost zeigt auf der Internationalen Funkausstellung (IFA) erstmals BTX (Bildschirmtext) - ein Dienst, der Fernseher mit Computern verbindet.
- 1984: Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling präsentiert das erste schnurlose Telefon fürs Festnetz.
- 1985: Das C-Netz nimmt offiziell seinen Betrieb auf - damit steigt die Zahl der Mobilfunkteilnehmer rasant. Dank zellularer Technik braucht man den Aufenthaltsort des Angerufenen nicht mehr zu kennen.
- 1989: Das Festnetz wird digital: offizieller Start des Integrated Services Digital Network (ISDN) in Deutschland.
- 1990: Das ARPANET wird abgeschaltet, die kommerzielle Nutzung des Internets beginnt. Auch Privathaushalte können sich ab jetzt via Modem einwählen.
- 1991: Wissenschaftler der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) entwickeln die sogenannte Hypertext Markup Language, kurz HTML, und machen das Internet damit massentauglich.
- 1992: Das Global System for Mobile Communications (GSM) wird eingeführt. GSM ist die technische Grundlage für digitale Mobilfunknetze. Das bringt den Durchbruch für den Mobilfunk. In Deutschland gehen die D-Netze an den Start - das D1-Netz der damaligen DeTeMobil Deutsche Telekom Mobilfunk GmbH und das D2-Netz von Mannesmann Mobilfunk.
Mit dem Transatlantic Telecommunications Cable TAT 10 kommt das erste transatlantische Glasfaserkabel zwischen Deutschland und den USA zum Einsatz. - 1994: Auf der Fachmesse CeBIT wird der erste SMS-Dienst in Deutschland vorgestellt. Eine Erfolgsgeschichte beginnt: Allein im Netz der Deutschen Telekom werden heute täglich rund 40 Millionen SMS versendet. (2011)
- 1996: Die Telekom geht im November an die Börse.
- 1998: Der Markt für Telekommunikation wird am 1. Januar geöffnet, der Wettbewerb um Festnetzkunden beginnt.
- 1999: Im Juli schaltet die Telekom die ersten Digital-Subscriber-Line-Anschlüsse (DSL) für Privatkunden. Mit DSL lassen sich Sprache und Daten gleichzeitig übertragen.
- 2000: Im Juni zählen die Netze D1 und D2 zusammen rund 25 Millionen Teilnehmer.
Die Telekom startet ihre Breitbandoffensive: 9 von 10 Haushalten in Deutschland haben die Möglichkeit, mit bis zu 3 Megabit pro Sekunde online zu gehen. - 2002: Premiere für UMTS: Nach A-, B-, C- und D-Netz startet die nächste Generation des Mobilfunks in Deutschland. Ende desselben Jahres zählt die Telekom bereits 3 Millionen Breitbandkunden.
- 2005: Als erstes Mobilfunkunternehmen ermöglicht die Telekom mit web'n'walk die mobile Internetnutzung. Im März zählt die Telekom bereits 6,4 Millionen DSL-Kunden.
- 2006: Telefon, Internet und Fernsehen aus einer Hand - mit dem Start von Entertain, dem IPTV-Angebot der Telekom, beginnt ein neues Multimedia-Zeitalter. Mit inzwischen rund 140 TV-Sendern, 15.000 Inhalten in Online-Videothek und TV-Archiv sowie interaktiven Anwendungen ist Entertain Marktführer im deutschen IPTV-Markt.
T-Mobile führt HSDPA ein und macht das mobile Internet für seine Kunden noch schneller. - 2007: T-Mobile verkauft in Deutschland exklusiv das iPhone.
- 2009: Telekom und Google launchen das erste Android-Handy.
- 2011: Mit Long Term Evolution (LTE) startet die neueste Generation des Mobilfunks. Außerdem beginnt die Telekom mit dem Ausbau ihres Glasfasernetzes, um ihren Kunden noch schnelleres Internet und digitales Entertainment ins Haus zu bringen.
Quelle: Deutsche Telekom AG
Umfrage zu Telefon 2011
17.10.2011

„Wussten Sie schon, dass...”
Kurioses und Interessantes aus 150 Jahren Telefon
07.09.2011
... die ersten Sätze, die Philipp Reis am 26. Oktober 1861 in sein „Telephon” sprach, ziemlich kurios waren? Sie lauteten: „Die Sonne ist von Kupfer” und „Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.”
... das erste deutsche Telefonbuch auch „Buch der Narren” genannt wurde? Es erschien am 14. Juli 1881 in Berlin mit dem Titel „Verzeichniss der bei der Fernsprecheinrichtung Betheiligten” und enthielt 187 Einträge.
... etwa 10 Prozent der Paare in Deutschland werktags nur über Telefon, SMS, Chat und E-Mail Kontakt halten, weil sie in einer Fernbeziehung leben?
... das „Rote Telefon” - Symbol für die Kommunikation zwischen Moskau und Washington während des Kalten Krieges - gar nicht existiert hat? Um gefährliche Missverständnisse beim Simultandolmetschen auszuschließen, gab es keine direkte Sprechverbindung zwischen den Staatsoberhäuptern der beiden Supermächte, sondern lediglich eine Fernschreiberverbindung.
... dafür aber die 300 wichtigsten Funktionäre der Kommunistischen Partei in China durch ein „Rotes Telefon” miteinander verbunden sind?
... die Briten Europameister im Verlieren von Mobiltelefonen sind? Jährlich verbummeln rund 4,5 Millionen Briten ihr Mobiltelefon: Allein etwa 800.000 Handys werden im Pub vergessen, 315.000 bleiben im Taxi liegen.
... sich das Leben für Angela Merkel (Red: 2011 Bundeskanzlerin) nach eigener Aussage „dramatisch verändert” hat, seit es SMS gibt? Sie schreibe Textnachrichten nicht nur während Sitzungen, sondern auch zu Hause beim Kochen. Die Handy-Mailbox hat die Bundeskanzlerin hingegen abgeschaltet - das Abhören der Nachrichten dauere ihr zu lange.
... fast 3 Millionen Deutsche nach eigenen Angaben schon einmal per E-Mail oder SMS eine Beziehung beendet haben?
... die Schauspielerin Marlene Dietrich ganz vernarrt ins Telefonieren war? Die Diva soll es auf monatliche Telefonrechnungen von 15.000 D-Mark gebracht haben.
... der Musiker Marius Müller-Westernhagen seiner Frau Romney Williams vor über 20 Jahren spontan am Telefon einen Heiratsantrag gemacht hat?
... in amerikanischen Spielfilmen Telefonnummern lange Zeit mit der „555” anfingen, die als Vorwahl gar nicht existierte? So wollte man mögliche Überschneidungen mit „echten” Telefonnummern vermeiden.
... das Telefon nicht nur in Filmen wie „Bei Anruf Mord” oder „Schlaflos in Seattle” eine zentrale Rolle spielt, sondern auch in vielen Songs? Von Helge Schneiders „Telefonmann” über „55555” von der Jazzkantine oder „Hanging on the Telephone” von Blondie bis hin zu „I Just Called to Say I Love You” gibt es mehr als 30 Hits über das Telefon.
... Peter Frankenfelds „Valsch Ferbunden” aus den 1960er Jahren die erste Radiosendung in Deutschland war, in der Telefonstreiche gespielt wurden?
... es in rund 1 Drittel aller Telefonate um Verabredungen geht?
... statistisch gesehen weltweit 6 von 10 Menschen ein Handy besitzen? Weder Autos noch Kühlschränke oder Fernseher sind so verbreitet wie Mobiltelefone.
... es in Deutschland aktuell rund 39 Millionen Festnetzanschlüsse gibt?
... 83 Prozent der Deutschen ab 14 Jahre über mindestens 1 Handy verfügen?
... 2011 weltweit voraussichtlich über 1,4 Milliarden Handys im Wert von 174 Milliarden Euro verkauft werden?
... das Mobiltelefon noch in den frühen 1990er Jahren für manche Zeitgenossen ein derart wichtiges Statussymbol war, dass sie nur für eine Attrappe rund 800 D-Mark ausgaben?
... es die ersten Ansätze für den Mobilfunk schon vor über 90 Jahren gab? 1918 wurde auf der Militärbahnstrecke zwischen Berlin und Zossen die Zug-Telefonie erprobt. 1926 wurde diese Technik in allen D-Zügen auf der Strecke Hamburg-Berlin eingeführt.
... die erste Telefonzelle 1904 in Berlin aufgestellt wurde? Eine echte Erfolgsgeschichte - bis sich das Mobiltelefon durchsetzte: 1989 gab es in Deutschland rund 162.000 Telefonzellen, 2009 waren es nur noch etwa 94.000.
... die Weiterentwicklung des Telefons durch eine Erpressung beschleunigt wurde? Erfinder Alexander Graham Bell wollte die Tochter seines Geldgebers heiraten, der jedoch seine Zustimmung davon abhängig machte, dass das Telefon zum Patent angemeldet werden konnte.
... die ersten Telefone außerhalb von Poststellen in Deutschland nur innerhalb von Unternehmen und wohlhabenden Haushalten eingesetzt wurden? Man rief damit ab 1877 etwa nach dem Schichtleiter oder der Dienerschaft.
... 1896 die ersten Telefone mit Wählscheibe eingesetzt wurden?
... das erste mobile Telefon fürs Auto alles andere als handlich war? Das Hauptgerät musste im Kofferraum untergebracht werden und wog 16 Kilo.
... man mit den ersten Autotelefonen besser am Straßenrand parkte, wenn man telefonieren wollte? Denn fuhr man während des Gesprächs von einem Sendebereich in den nächsten, wurde die Verbindung unterbrochen. Der Anrufer musste den neuen Kanal erst per Hand suchen.
... das erste richtige Handy länger als eine DIN-A4-Seite war und im Juni 1983 auf den Markt kam? Mit 800 Gramm wog „der Knochen” so viel wie eine Flasche Wasser und bereits nach einer halben Stunde Sprechzeit war sein Akku leer.
... die erste SMS am 3. Dezember 1992 verschickt wurde? 2011 werden die Deutschen voraussichtlich mit 46 Milliarden Kurznachrichten für einen neuen SMS-Rekord sorgen.
... zum Jahreswechsel 2010/2011 fast 70 Millionen SMS allein im Netz der Deutschen Telekom verschickt wurden? An einem normalen Tag sind es um die 35 Millionen Kurzmitteilungen.
... Barack Obama bereits unmittelbar nach seiner Wahl zum Präsidenten der USA im November 2008 zum Telefonhörer griff, um mit 9 seiner zukünftigen Amtskollegen in aller Welt erste Absprachen zu treffen? Moskau stand übrigens nicht auf seiner Anrufliste.
... Salavador Dalís berühmtes Hummer-Telefon voll funktionstüchtig war? Der Künstler nutzte einfach einen seinerzeit gebräuchlichen englischen Telefonapparat und setzte die bemalte Gipsattrappe eines Hummers darauf.
... die bundesweit einheitliche Notrufnummer der Polizei - die 110 - im Jahr 1973 eingeführt wurde? Vorher musste man die unterschiedlichen Rufnummern der örtlichen Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes kennen, um im Notfall Hilfe herbeirufen zu können.
... es in Deutschland 120 Notruf-Einrichtungen gibt und dort alle 20 Sekunden ein Gespräch beginnt?
... Philipp Reis dem „Telephon” seinen Namen gab? Der Begriff setzt sich zusammen aus „tele” (griechisch für „fern”) und „phone” (Laut, Ton, Stimme, Sprache).
... in den Telefonvermittlungsstellen zunächst junge Männer eingesetzt wurden? Sie wurden jedoch bald durch Frauen ersetzt, weil deren höhere Stimmlage am Telefon besser zu verstehen war. So entstand ein neues Berufsbild: das „Fräulein vom Amt”. Die Telefonistinnen mussten jung, ledig, gebildet und aus gutem Hause sein.
... ein misstrauischer Bestattungsunternehmer die automatische Vermittlung erfand? Almon Strowger argwöhnte, die Damen in der Vermittlungsstelle seiner Heimatstadt würden Anrufe von Hinterbliebenen bevorzugt an die Konkurrenz weiterleiten. Deshalb entwickelte er den Hebdrehwähler - Basis für die ersten automatisch arbeitenden Telefonvermittlungsstellen.
Quelle: Deutsche Telekom AG
... die Phrase „The quick brown fox jumps over the lazy dog” (der schnelle braune Fuchs springt über den faulen Hund), mit 35 Buchstaben, als meistbenutzter Test für Schreibmaschinen und Tastaturen dient, da es sich dabei um ein kohärentes und kurzes Pangramm des englischen Alphabets handelt, also alle darin vorkommenden Buchstaben abdeckt. Dieser Satz wurde 1988 von der ITU-T in 3 verschiedenen englischsprachigen Versionen als Prüftext in der Empfehlung R.52 beschrieben.
Quelle: Wikipedia „Pangramm”
20 Jahre Mobilfunk: 1992 - 2012
Vodafone: 20 Jahre D2-Netz
Von 1992 bis 2012 - Informatives und Kurioses aus 2 Jahrzehnten Mobilfunk
30.06.2012
 Am 30. Juni 1992 wurde das D2-Netz gestartet.
Am 30. Juni 1992 wurde das D2-Netz gestartet.
Wirtschaftsfaktor Mobilfunk
Neue Arbeitsplätze, neue Berufsbilder
Die Geschichte des Mobilfunks in Deutschland ist auch die Erfolgsgeschichte einer hochdynamischen Branche und die eines bedeutenden Wirtschaftsfaktors für den heimischen Standort. Es fing alles mit einem Stück Papier an: die Lizenz für den Betrieb eines Funknetzes. Damals wusste niemand, ob die Technik - die nur in Laboren erprobt war, in der Praxis auch funktionieren würde. Sie tat es und wie: Es wurden durch den digitalen Mobilfunk weit mehr als 100.000 neue Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen.
Im Umfeld der Mobilfunktechnik entwickelte sich über die Jahre eine vielfältige moderne ITK-Industrie, die von Entwicklern, Herstellern und Zulieferern bis hin zu Vertriebspartnern und Dienstleistungsunternehmen reicht - inklusive der vielen Bauunternehmen und Zulieferern vor Ort, die von Aufträgen aus der Branche profitieren. Nicht zuletzt multifunktionale Smartphones und die rasante Verbreitung des mobilen Internets lassen zudem ganz neuartige, nie da gewesene Berufsfelder entstehen - vom Hardware-Designer über den Programmierer für Handy-Betriebssysteme bis hin zum Aggregator für Musik, Spiele und Videoclips und TV-Angebote auf dem Handy.
Allein Vodafone hat in Deutschland bereits mehr als 20 Milliarden Euro ins Netz investiert. So entstand bis heute eine moderne Infrastruktur, die von zahlreichen anderen Wirtschaftszweigen (Versicherungen, Automotive, Maschinenhersteller, Energie, Gesundheitswesen, Verkehr und Logistik usw.) genutzt wird. Die Mobilfunk-Technologie erleichtert Weltkonzernen, Großunternehmen, mittelständischen Betriebe und auch Selbstständigen den Arbeitsalltag. Auch ist der Mobilfunk dank zahlreicher innovativer Produkte Lebensader und Treiber für die Gesamtwirtschaft. Er bildet eine wichtige Grundlage, damit Deutschland im 21.Jahrhundert - dem Zeitalter der Informationsgesellschaft - im internationalen Vergleich wettbewerbsfähig ist. Auch das sichert Arbeitsplätze für den Industriestandort Deutschland.
Handover im In- und Ausland
Verbunden in Lichtgeschwindigkeit
Mysterium und Alltäglichkeit: Überall auf der Welt weiß mein Handy, wo ich gerade bin. Aber wie funktioniert das? Den Schlüssel birgt die SIM-Karte. Nehmen wir mal Karin. Sie ist Kundin von Vodafone Deutschland und in Neuseeland im Urlaub. Schaltet sie ihr Handy ein, bucht sich die SIM-Karte in ihrem Handy in das nächste Vodafone- oder ein Partner-Netz ein. Die bevorzugten Netze sind im Handy gespeichert. Doch die Karte kann mehr. Beim Einschalten wird ein Identifikationscode übermittelt. Das Netz weiß jetzt: Karin ist in Neuseeland zu Gast - im Netz von Vodafone Mobile New Zealand Limited. In Lichtgeschwindigkeit tauschen ihr Anbieter zu Hause und der Netzbetreiber am Urlaubsort die nötigen Infos aus - binnen Millisekunden! Und schon kann Karin telefonieren, simsen und surfen. Grundlage sind weltweit digitalisierte Sprach- und Daten-Protokolle, wie sie etwa der weltweite Standard Global System for Mobile Communications (GSM) vereint.
Herzstück für den grenzenlosen Infoaustausch ist das sogenannte „Home Location Register” des jeweiligen Netzbetreibers. Das Verzeichnis aller deutschen Vodafone-Kunden entschlüsselt den Identifikationscode und merkt sich: Karins Handy ist in Neuseeland - und dort an einer bestimmten Antennenstation - angemeldet. Und es weiß, was Karins Handy alles darf - zum Beispiel Telefonieren. Wählt jemand Karins Nummer, wird flugs ein Signal an die Mobilfunkstation geleitet, an der ihr Handy angemeldet ist. Ist die Verbindung in Ordnung, das Handy sprachbereit, kommt eine OK-Meldung zurück. Dann wird das Gespräch aufgebaut und Karins Handy klingelt. Ganz einfach. Und falls Karin bei einem angenommenen Gespräch mit dem Zug fährt, wird das Telefonat ohne Unterbrechung - quasi wie von Geisterhand - von einem Antennenstandort zum nächsten weitergegeben. Das nennen Techniker „Handover”.
Nahezu unheimlich ist die Schnelligkeit, in der diese Aktionen laufen: 1.079.252.849 Kilometer würde das Signal in einer Stunde zurücklegen. Rund um den Globus dauert es demnach nur 0,13 Sekunden! Die Daten rasen als elektromagnetische Wellen im Kupferkabel oder über Lichtsignal im Glasfaserkabel rund um den Globus. Netzverbindungen gibt es auf dem Land, im Wasser und in der Luft. Tiefseekabel leiten heute Millionen von Telefonaten und riesige Datenmengen von Kontinent zu Kontinent. Das erste Telekommunikationsseekabel von Borkum über die Azoren nach New York war übrigens 7.993 Kilometer lang und wurde schon 1904 gelegt. Damals bestand das Kabel aus Kupfer. Glasfasertechnik für transatlantische Verbindungen gibt es erst seit Ende 1988. Mit dem ersten Kabel waren 30.000 Telefonate gleichzeitig möglich. Heute liegen in den Weltmeeren insgesamt 385.000 Kilometer Seekabel, die 62 Millionen Telefonate übermitteln können. Und wir sind heute mobil überall erreichbar.
Kurznachrichten
160 Zeichen zum Erfolg: Siegeszug der SMS und MMS
Die Deutschen nutzen ihn täglich, und zwar rechnerisch 1,8 Mal pro Tag - den „Short Message Service”, kurz SMS. Binnen weniger Sekunden ist mit 160 Zeichen die Kurznachricht getippt und versendet. Mittlerweile ist das „Simsen” und dessen Weiterentwicklung MMS (Multimedia Messaging Service) Alltag. So haben die deutschen Vodafone-Kunden in den vergangenen 10 Jahren rund 130 Milliarden SMS versendet - bei jährlich steigender Tendenz. Die erste Kurzmitteilung des Short Message Service wurde am 3. Dezember 1992 mit dem Text „Merry Christmas” von einem PC an ein Mobiltelefon im britischen Vodafone-Netz gesendet. Seitdem ist der Siegeszug der Kurznachrichten nicht mehr aufzuhalten. 2011 versendeten alle Handynutzer in Deutschland insgesamt rund 55 Milliarden SMS, fast 1 Drittel mehr als im Vorjahr. In den vergangenen 5 Jahren hat sich die Zahl übrigens mehr als verdoppelt.
Durch die hohe Akzeptanz sind Kurznachrichten Trend. Zudem sind bei den zeichenbeschränkten Kurznachrichten vielfältige Kreationen entstanden. Denn um mehr Inhalt in die auf 160 Zeichen beschränkten Nachrichten zu bringen, hat sich in den ersten Jahren der technischen Innovation eine weitverbreitete Abkürzungskultur entwickelt. Jeder kennt etwa „hdgdl”*) oder das „Smiley” aus einfachem Doppelpunkt, Minuszeichen und Klammer-zu-Zeichen. Kurz eingetippt, lächelt einem ein schräggestelltes Gesicht auf dem Display entgegen. Heute ist die 160-Zeichen-Enge technisch überholt, da längere Textnachrichten gesplittet übermittelt und wieder zusammengesetzt werden. Seit einigen Jahren komplettieren vorgefertigte Emoticons, Gesichter mit allen passenden Ausdrucksformaten, die SMS-Technik.
Vodafone hat in den vergangenen 10 Jahren rund 130 Milliarden Nachrichten der Kunden über das eigene Netz versendet. Allein 2011 waren es fast 20 Milliarden. Nun setzt Vodafone die Erfolgsgeschichte der Kurznachrichten fort und bereitet den Start des neuen Kommunikationsdienst RCS-e vor. Damit können Smartphone-Nutzer so einfach wie nie zuvor Nachrichten versenden und empfangen, Dateien wie etwa Dokumente, Fotos und Videos austauschen und auch in einem laufenden Sprach-Telefonat eine Video-Verbindung starten und den Gesprächspartner sehen. Die Kurzbotschaften wachsen so zum Universalservice.
*) HDGDL = „Hab' dich ganz doll lieb”, neuerdings kontextabhängig auch als „Hab' dich gedisst, Loser!” zu verstehen. „dissen” (von engl. disrespect, discriminate oder discredit abgeleitetes Verb to diss; Abkürzung für diskreditieren oder diskriminieren), hauptsächlich von Jugendlichen verwendet, bedeutet jemanden schlechtmachen, jemanden schräg anmachen, respektlos behandeln oder jemanden schmähen. Seit 2000 ist das Wort im Rechtschreib-Duden gelistet. Quelle: Wikipedia 2012
Rechnerleistung
Rasante Entwicklung: Von Apollo bis Velocity
Aktuelle Handys im Vergleich mit dem Rechner in der Mondlandefähre
Bei der Mondlandung im Juli 1969 hielt die Menschheit den Atem an. Den Weg zum Erdtrabanten und zurück unterstützten Rechenhelfer in der Mondlandefähre. Seitdem ist der Fortschritt in Sachen Datenverarbeitung atemberaubend: Ein heute handelsübliches Handy hat mehr Rechenleistung als das einstige elektronische Superhirn der Apollo-Mission in der Weltraumkapsel. Die Mobilfunktelefone von heute sind dazu im Vergleich Alleskönner, die sich zudem täglich im Dauerbetrieb behaupten müssen. Sie sind das sichtbare Fortschrittssymbol für die rasante Entwicklung der Mobilfunktechnik der vergangenen 20 Jahre.
Beide Gerätetypen sind für sehr unterschiedliche Zwecke konzipiert: Der „Apollo Guidance Computer” an Bord der Apollo 11 berechnete ballistische Bahnen, diente der Navigation und leitete Informationen weiter. Hingegen empfängt und versendet ein modernes Mobiltelefon digitale Signale und wandelt sie in Sprache Bilder, Videos oder Musik um.
Ausstattung und Rechenleistung beider Rechner belegen die rasante technologische Entwicklung: Der Apollo-Computer verfügte über einen Arbeitsspeicher von rund 4 Kilobyte und schaffte etwa 40.000 Additionen pro Sekunde. Seine Taktrate lag bei 2,048 MHz. Ein heutiger Chip ist deutlich schneller. Ein Mobiltelefon ist zwar nur bedingt ein Computer, aber auch in den kleinen Geräten stecken leistungsfähige Chips. Sie sorgen mit großem Rechenaufwand zum Beispiel für die Verarbeitung von Sprachsignalen oder die Übertragung von HD-Videos in Echtzeit. Der Prozessor des ersten Handy für die 4. Mobilfunkgeneration LTE erreicht eine 1,5-GHz-Taktung; sein Programmspeicher umfasst 16 Gigabyte, der Arbeitsspeicher rund 1 Gigabyte. Der emsige Datenspezialist ist für seine Aufgabe gut gerüstet. Bis zu 50 Mbit/s Surfgeschwindigkeit erreicht beispielsweise das Modell HTC Velocity 4G.
Im Vergleich dazu herrschte bei der Mission Apollo 11 eine nach heutigen Verhältnissen geradezu beschauliche Datenlage. Der eigens für die Mission konstruierte „Guidance Computer” wog 30 Kilo und war mit einem taschenrechnerähnlichen Eingabefeld versehen. Zahlenverhältnisse, die in der heutigen Welt der Smartphones eine schlechte Wahl wären. Und noch ein Vergleich: Heute bemisst man die Speicherleistung eines modernen Hochleistungsrechner nicht mehr in Kilo-, sondern in Giga- und sogar Terrabyte. Übrigens beschreibt das Lexikon der Astronomie, dass in der Mondladefähre 3 Computer zur Sicherung parallel geschaltet waren - beim Landeanflug fielen sie dann gemeinsam wegen Überlastung aus.
Viele Bezeichnungen für ein Gerät
Typisch deutsch: Wir sind Handy!
Den Begriff gibt es in keinem anderen Land.
„Handy”, „cellphone” oder „portable” - ausgerechnet beim Kommunikationssymbol der Gegenwart herrscht bei der Bezeichnung geradezu babylonisches Sprachgewirr. Je nach Land wird es als Mobiltelefon, Handmaschine oder Wundertelefon bezeichnet. Auch wenn „Handy” durchaus englisch klingt, ist der Begriff jedoch eine rein deutsche Bezeichnung. In England nennt man die kommunikativen Alleskönner übrigens auch „mobile phone”.
Die Bezeichnung „Handy” fand mit dem Start der D-Netze ab 1992 Einzug in den deutschen Sprachgebrauch. Woher sie kommt, ist letztendlich nicht genau zu klären. Aber es gibt unterschiedliche, zum Teil auch humorvolle Erklärungsansätze. Etwa den des von Motorola im Zweiten Weltkrieg produzierte „Handie-Talkie SCR-536”, das man wie ein Telefon in der Hand halten konnte. Sprachexperten allerdings glauben nicht, dass das Wort auf diesen Ursprung gründet, da die Existenz des „Handie-Talkie” Anfang der 1990er Jahre wohl nicht mehr allgemein bekannt war.
Und auch bei der Telekom kursiert eine Geschichte zum Namensursprung. So soll ein leitender Postbeamter im Jahr 1988 auf der Suche nach einem Wort für die Vermarktung eines portablen Telefongeräts gewesen sein. Das bahnbrechend Neue: Man konnte das rund 1 Pfund schwere Gerät mit einem Preis von damals rund 10.000 DM überall mit sich herumtragen. In einer internen Brainstorming-Runde soll dann jemand das Wort „Handy” gemurmelt haben. Einziger Schönheitsfehler an der Geschichte: Auf dem Gerät stand dann nicht „Handy” sondern „Pocky” und bei T-Mobile ist kein einziges Schriftstück auffindbar, das ein Funktelefon aus der damaligen Zeit als „Handy” bezeichnet. Die Schwaben hingegen haben eine nette und gleichfalls selbstironische Erklärung für den Begriff: Aus „Hen die koa Schnur?” (Haben die kein Kabel dran?) wurde der Legende zufolge der Begriff Handy.
Tatsache ist: Das erste D-Netz-Mobiltelefon, das den Begriff Handy im Namen führte, wurde 1992 von Loewe vorgestellt und trug den Namen „HandyTel 100”. In anderen Ländern richtete sich die Bezeichnung nach der Eigenschaft des Gerätes, die Portabilität mit dem lateinischen Wortstamm „mobile”. Diesen Zusatz tragen die Geräte in vielen Sprachen. Aber es gibt auch Alternativen wie Tragbares (Frankreich), Wundertelefon (Israel) oder Handmaschine (China). Wo immer der Begriff Handy nun auch herkommt, er ist lupenreines Deutsch.
Lizenzvergabe
D2-Lizenz: Erstaunliches Comeback der „Verlierer”
Medienhäuser, Automobilkonzerne und Energieversorger
Am 30. Juni 1992 wurde in Deutschland das D2-Netz - und damit das erste digitale Mobilfunknetz - gestartet. Bei der vorherigen Lizenzvergabe zählte alles, was in der deutschen und europäischen Wirtschaft Rang und Namen hatte, zum einstigen Bewerberreigen: Darunter befanden sich neben dem Siegerkonsortium, das von Mannesmann angeführt wurde, namhafte deutsche Konzerne wie MAN, Daimler, BMW, RWE, Axel Springer, WAZ, Veba und Salzgitter oder auch ausländische Unternehmen wie Shell, British Telecommunications und Bell Atlantic. Insgesamt 10 Konsortien hatten sich 1989 um den Ausbau des geplanten GSM-Netzes (Global System for Mobile Communications) beworben. Und das Erstaunliche dabei: Viele der Unternehmen aus dem damaligen Bewerberkreis mischen heute munter im Mobilfunk mit oder setzen in der eigenen Branche auf mobile Anwendungen.
So sind die damaligen „Verlierer” der Lizenzvergabe wie Springer-Verlag und WAZ-Gruppe heute mit eigenen Discountmarken (Bild mobil, Wir mobil) im Mobilfunkmarkt 2012 vertreten. Zudem bieten viele Medienhäuser ihre Informationsangebote inzwischen auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablet PC digital an - etwa über Zeitungskioske in den App-Stores. Die Automobilindustrie wiederum entwickelt intelligent vernetzte Fahrzeuge, die sich via Mobilfunk gegenseitig vor Gefahren warnen und sogar ohne menschliches Zutun sicher steuern lassen. Moderne Fahrzeuge haben bereits jetzt das mobile Internet mit an Bord und ebenso ein automatisches Notrufsystem (eCall), das bei einem Unfall automatisch per Mobilfunk die Retter der europaweit einheitlichen „112” alarmiert.
Die damals unterlegenen Energieerzeuger wiederum setzen heute auf intelligente Stromzähler (Smart Meter). Diese liefern über Mobilfunk den aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit und tragen durch diese Transparenz dazu bei, Angebot und Nachfrage an Strom besser zu koordinieren. Ebenso können Energieverbrauch und CO2-Ausstoß dank der Smart Meter deutlich reduziert werden - ein aktiver Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz.
Start digitaler Mobilfunknetze
Am Anfang war das D2-Netz
Es ist die Wiege der modernen Mobilfunkgesellschaft in Deutschland: der Start der digitalen Mobilfunknetze vor 20 Jahren. Ob Sprachübertragung, Surfen oder Simsen, überall und jederzeit sind wir heute erreichbar. Die ersten Weichenstellungen erfolgten wagemutig aber bereits Mitte der 1980er Jahre: Ein einheitlicher Standard sollte die bis dahin separaten und analogen Funknetze in Europa vereinen und Kommunikation wie auch Wettbewerb innerhalb des Kontinents mit digitaler Technik stärken. Treibende Kräfte damals: Frankreich, Italien und Deutschland. Von der Idee zur digitalen Realität sollte es fast eine Dekade dauern. Doch 1992 war es dann soweit. Die ersten privaten GSM-Netze (Global System for Mobile Communications) gingen in Deutschland, Frankreich, Italien, Portugal, Dänemark, Schweden und Finnland an den Start. In Deutschland funkten ab 30. Juni D2, am darauffolgenden Tag auch D1. 2 Jahre später folgten 13 weitere europäische Länder. Heute ist GSM weltweit eine Erfolgsstory und Vorbild für Netze neuer Generationen, etwa für den Mobilfunkstandard LTE.
Was vor 20 Jahren im Kleinen begann, hat inzwischen die Welt erobert. GSM ist der am weitesten verbreitete Mobilfunkstandard. Heute gibt es weltweit mehr als 4,4 Milliarden GSM- und rund 6 Milliarden Mobilfunk-Nutzer. Und alle können sich miteinander verbinden - denn die Mobilfunknetze funken weltweit auf harmonisierten Protokollen.
In Deutschland markierte das Jahr 2006 einen nachhaltigen Durchbruch: 14 Jahre nach der Einführung der auf dem europäischen Mobilfunk-Standard GSM basierenden Netze kam es zur statistischen Vollversorgung. Vom Säugling bis zum Greis besitzt statistisch jeder Deutsche seither mehr als 1 für die mobile Telefonie notwendige SIM-Karte.
Und die Entwicklung ging weiter. Mit der schnellen Datenübertragung UMTS, eine Abkürzung für das „Universale Mobile Telekommunikations-System”, wurden Video-Telefonie, Nachrichtendienste, Internetzugang und Navigation möglich. Mittlerweile sorgt auch der Nachfolge-Übertragungsstandard HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) für hohe Datenraten nach dem UMTS-Standard. Doch das ist nicht Ende der Fahnenstange. Das neue Zauberwort in Sachen Mobilfunk heißt LTE.
Das Kürzel steht für „Long Term Evolution” und wird als Mobilfunktechnologie der 4. digitalen Generation auch als 4G bezeichnet. Mit LTE sind schon heute Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Download und bis zu 10 Megabit pro Sekunde im Upload möglich. Ende 2012 sollen Prognosen zufolge 22 Millionen Menschen weltweit LTE nutzen. 2 Jahre später könnten es bereits mehr als 150 Millionen sein. Vodafone bietet seit Dezember 2010 seinen Kunden LTE-Tarife und LTE-Hardware an.
Mobilfunk verdrängt Festnetz
Mobil ist Trend: überall statt kabelgebunden
Die Richtung ist eindeutig: mobil ist Trend. In kaum 2 Jahrzehnten verdrängt der noch junge Mobilfunk zunehmend die 150 Jahre alte Festnetztechnik. So stieg die Summe der Handy-Gespräche in Deutschland im vergangenen Jahr um fast 6 Prozent auf 180 Milliarden Minuten. Jeder Bundesbürger telefonierte 2010 im Schnitt gut 3 Stunden im Monat mobil. Und seit 2005 hat sich das Gesprächsvolumen mehr als verdoppelt. Hingegen sind die Gesprächsminuten im Festnetz im vergangenen Jahr um 2 Prozent auf 191 Milliarden Minuten gesunken. In diesem Jahr wird die Zahl der Handy-Minuten voraussichtlich auf rund 192 Milliarden steigen und die Festnetz-Minuten erstmals übertreffen. Waren Handytelefonate früher noch die Ausnahme, sind sie heute aufgrund der technischen Entwicklung sowie der stark gesunkenen Preise und Flatrate-Tarife eine Selbstverständlichkeit.
Die Vergleichswerte hat der Hightech-Verband BITKOM auf Basis aktueller Daten der Bundesnetzagentur erstellt. Auch Vodafone kann diesen Trend mit imposanten Zahlen untermauern. In der jüngsten Gesamtjahresschau des Kommunikationskonzerns haben die Kunden sage und schreibe mehr als 51,5 Milliarden Mobilfunkminuten telefoniert. Das sind übrigens 125 Minuten oder rund 2 Stunden pro Kunde im Monat. Ein sattes Plus im Vergleich zum Vorjahr von knapp 4,3 Milliarden Mobilfunkminuten.
Und innerhalb des Festnetzes findet ein Wandel statt: Die Nutzung klassischer Telefonnetze und Schmalbandnetze wie analoge Anschlüsse oder ISDN nimmt stetig ab. Es vollzieht sich ein Wandel zur IP-Technik: Die Netzgeneration NGN prägt steigend die Wahl der Verbraucher: Sie entscheiden sich für das Telefonieren über IP-basierte Telefondienste. 2010 lag deren Anteil bei einem Fünftel (21 Prozent), 2009 waren es noch 18 Prozent.
Der Rückgang der Festnetztelefonie verläuft in Deutschland jedoch langsamer als in anderen Ländern. So telefonieren nur 12 Prozent der Haushalte hierzulande ausschließlich mit dem Handy. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich - noch - auf den hinteren Rängen.
Universelle Helfer
Vom Knochen zum Alleskönner
Handys im Wandel der Zeit
Immer kleiner, immer feiner und vor allem - immer dabei: Das ist die erfolgreiche Geschichte der Mobiltelefone in den vergangenen 20 Jahren. Handys sind heute ständige Begleiter, ob im Beruf oder privat, und sie beherrschen eine Vielzahl von Funktionen. Dabei waren die Anfänge der ersten Modelle nicht besonders glamourös. Unhandliche Geräte mit Leistungsdaten, die heute fast lächerlich erscheinen. Die Metamorphose lautet: Vom „Knochen” zum Alleskönner.
Die Vorläufermodelle der heutigen Handygeneration prägte bereits das sogenannte analoge Funknetz: Das erste Mobiltelefon wurde 1983 vorgestellt. Das Gerät von Motorola hieß DynaTAC 8000X und war wie die ersten Nachfolgemodelle mit einer Länge von über 30 Zentimeter und einem Gewicht von knapp 1 Kilo für heutige Verhältnisse ein gewaltiger Brocken. Er passte in keine Hosentasche und erhielt nicht umsonst den Beinamen Bone, zu Deutsch „Knochen”. Maximal 1 Stunde konnte der glückliche Besitzer mobil telefonieren, dann machte der Akku schlapp. Dafür hatte das Gerät einen stolzen Preis: Knapp 4.000 Dollar, umgerechnet gut 2.800 Euro, kostete es damals. Dennoch wurde es ein Verkaufsschlager.
Das erste GSM-fähige Handy war das Motorola International 3200. Damals eine Revolution, heute ein sperriges Ding. Mit knapp 20 Zentimetern und einer Telefonierdauer von 2½ Stunden ist es im Vergleich zum heutigen Kulthandy iPhone mit einer Größe von 11,5 Zentimetern und einer 14-stündigen nonstop Telefonierleistung ein schwächliches Ungetüm. Ganz abgesehen von den anderen Funktionen, wie etwa der Kamera, dem Internetzugang oder Musikhören. Beim „Knochen” war an solche Möglichkeiten nicht zu denken.

Foto: Vodafone
War der Mobilfunk einst eine Innovation für die Elite wuchs er mit sinkender Preisschwelle in den D-Netzen zum Produkt für jedermann. Und heute: Statistisch gesehen kommen auf jeden Einwohner Deutschlands knapp 1,4 Mobilfunkanschlüsse (Ende März 2012). Viele Nutzer haben mehr als 1 Vertrag, ein Handy wird privat, eines dienstlich genutzt, und die Partnerkarte ermöglicht das Zweitgerät für die Familie. Tatsächlich besitzen rund 83 Prozent der Bevölkerung ein Handy und zunehmend ein Modell mit Zusatzfunktionen.
Die Mobilfunktelefone haben dafür eine rasante Entwicklung durchlaufen. Ihre Modellanzahl ist vielfältig und jedes aktuelle Smartphone ein Leistungsträger mit einer großen Anzahl an Applikationen, also Serviceprogrammen. Musikplayer, Foto- und Videokamera, die elektronische Post sind oft inklusive. Im Jahr 2011 wurden erstmals mehr Smartphones als übliche Handys abgesetzt. Jeder 3. Deutsche besitzt einen solchen Alleskönner, sogar jeder 2. bei den unter 30-Jährigen. Beflügelt wird der Trend durch steigende Datenraten im Mobilfunk: Zwischenzeitlich toppt der Mobilfunkstandard LTE bereits die kabelgebundene DSL-Anbindung auf der Kupferbasis.
Beginn des D2-Netzes
Start in ein vernetztes Land
Der Sommer 1992 markiert in Deutschland den Beginn der heutigen Mobilfunklandschaft in Deutschland: Die Netze D2 und D1 starteten nahezu zeitgleich. Für D2 erwies sich der Beginn der Mobilfunkzeitalters zunächst als Start mit Hürden und Hindernissen, wie ein Rückblick zeigt.
Für das D2 Netz war ein Januartag im Jahr 1991 historisch. Die Spannung muss fast greifbar in der Luft gelegen sein, denn rückblickend setzte Wolfgang Wussow, Geschäftsführer Finanzen der damaligen Mannesmann Mobilfunk (MMO), mit dem allerersten D2-Telefonat einen Meilenstein für die Mobilität von Millionen Menschen. Er telefonierte aus einem Testwagen des Netzausrüsters Ericsson mit Lee Cox von Pacific Telesis in San Francisco.
Zuvor war offiziell am 15. Februar 1990 der Lizenzvertrag für das D2-Netz unterzeichnet worden, kurze Zeit nach den epochalen Veränderungen in Deutschland mit der späteren Vereinigung. Keiner hatte bei der Planung diese umwälzenden Entwicklungen absehen können. Deshalb erstreckte sich die D2-Lizenz ursprünglich auch nur auf die alten Bundesländer und Westberlin. Eine neue Planung musste nach der Wiedervereinigung her, kurzfristig und doch mit gleicher Qualität. Die 2. Planung legte das Fundament für ein gesamtdeutsches Netz. Sie mündete schließlich in der zusätzlichen Genehmigung für den Aufbau des D2-Netzes in den neuen Bundesländern. Diese wurde im Februar 1991 erteilt.
Doch die Startschwierigkeiten für das D2-Netz hatten eine Fortsetzung. Zwar liefen die Investitionen für die Infrastruktur weiter und das Netz war Mitte 1991 startklar, es fehlten aber die einkalkulierten Einnahmen. Der Grund: Es gab keine Mobiltelefone, mit denen Kunden das D2-Netz hätten nutzen können. Der kommerzielle Netzstart verzögerte sich daher bis in den Juni 1992 hinein. In dieser Zeit wandelte sich das Standardkürzel „GSM” (Global System for Mobile Telecommunications) in eine Art Stoßgebet: „God Send Mobiles!”
Die Wende zum Besseren zeichnete sich erst Anfang Juni 1992 ab. Dann nämlich erhielten die ersten Hersteller von GSM-Mobiltelefonen wie Ericsson und Motorola die europaweite Zulassung für ihre Prototypen. Die Produktion konnte anlaufen und Ende Juni 1992 waren die ersten Tausend kommerziellen Mobiltelefone verfügbar. Der private Netzbetrieb konnte endlich gestartet werden, zwar einige Zeit später als geplant, aber noch einen Tag vor dem damals staatlichen Wettbewerber D1. Und nun begegnete dem Mobilfunk eine mittlerweile 20 Jahre andauernde Fortsetzung: die Innovationskraft für mobile Leistungen erfordert stetig neue Technologien und Netzerweiterungen - aktuell gestaltet Vodafone mit LTE die 4. Mobilfunkgeneration.
Motor des Fortschritts
Innovationstreiber Mobilfunk
Die Telekommunikation ist Innovationstreiber - deutlich sichtbar an der Entwicklung der Netzgenerationen und ihrer Anwendungen. Konnten mit den ersten Handys nur Telefongespräche geführt werden, drangen bald schon viele neue Trends in die Mobilfunkgeräte: SMS, MP3 Player, Fotokamera, Navigation und schließlich der Internetzugang inklusive Applikationen. Heute ist neben der Mobilität die Vernetzung in der Informationsgesellschaft zur Alltäglichkeit geworden.
Grundstein der Innovationen waren und sind die Protokolle des Mobilfunkstandard GSM. Er bot und bietet Spielraum für kühne Ideen und ist ein solides Fundament für die Entwickler.
Die ersten Mobiltelefone für die GSM-Technik waren reichlich voluminös und spartanisch in der Ausstattung. Dahinter steckte aber lediglich der akute Einstieg in die Produktion von Geräten bei vorhandenem D2-Netz. Ein Innovationsfeuerwerk mit unzähligen integrierten Funktionen folgte. Augenscheinlichste Kriterien dabei: Das Gewicht schrumpfte, die Preise ebenfalls. Und zwar rapide. Die Netzevolution führte zu GPRS und EDGE - zunächst mit schmaler Internetleistung und eigens für die Mobilfunkwelt angepassten WAP-Portalen. Mit UMTS wuchs das mobile Breitbandnetz. Heute sind das Surfen mit dem Smartphone im „richtigen” Internet, die ständige Vernetzung zur Social Community via Facebook, Twitter, Xing & Co oder die Servicevielfalt per Applikationen Alltag.
Nun steht der Durchbruch von der sogenannten Megabit- zur Gigabitgesellschaft an. Treiber dabei ist die LTE-Technologie (Long Term Evolution). Damit sind schon heute Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde im Download und bis zu 10 Megabit pro Sekunde im Upload möglich. Der Vorteil: Große Dateien und selbst hochauflösende Videos können in Hochgeschwindigkeit aus dem Netz heruntergeladen und auch versandt werden.
Bereits im Sommer 2010 hat Vodafone in bundesweit bisher unterversorgten ländlichen Regionen mit dem Ausbau begonnen. Seit Dezember 2010 bietet Vodafone seinen Kunden LTE-Tarife und LTE-Hardware an. Derzeit steht in mehreren Tausend Gemeinden in ganz Deutschland auf mehr als 40 Prozent der Fläche rund 14 Millionen Haushalten die neue Mobilfunkgeneration zur Verfügung. Damit ist das turboschnelle Surfen in bisher unversorgten Gebieten in ganz Deutschland möglich. Und auch diese Weiterentwicklung des Netzes wird kluge Köpfe zu neuen Innovationen antreiben. Die erste LTE-Handygeneration ist auf dem Markt und auch LTE-Tablets verbreiten sich rasant. Die kleinen Flachbildschirme für unterwegs können punkten durch ihre multimediale Vielfalt, streamen TV Programme und bieten die Tageszeitung oder Bücher auf dem Bildschirm.
Und in Zukunft? Laut einer Studie des Netzwerkausrüsters Ericsson wird es im Jahr 2017 9 Milliarden Smartphones weltweit geben - davon 5 Milliarden mit Breitbandanschluss. Und bei Teilnehmern, die permanent online sind, dürfte nach diesen Schätzungen der Datenverkehr in den Mobilfunknetzen in den nächsten 5 Jahren um das 15-fache anwachsen. Und auch hier gilt: Das Netz ist die Wurzel der Innovation.
Premiere
Das ist Deutschlands erster Handy-Kunde
Günter Brandt besorgte sich Mobiltelefon im Ausland und SIM-Karte bei D2
Günter Brandt hat Mobilfunkgeschichte geschrieben. Der Personalberater war der erste Kunde im D2-Netz in Deutschland. Denn der Bochumer hat vor 20 Jahren als erster einen D2-Mobilfunkvertrag unterzeichnet. Auf der Hightech-Messe CeBIT erhielt er im März 1992 seine SIM-Karte. Und das, obwohl das D2 Netz noch nicht offiziell eröffnet war und es eigentlich gar keine Mobiltelefone in Deutschland gab.
Günter Brand hatte aber bereits ein Handy - genauer ein Telefon mit D-Netz-Technik. Er hatte das Gerät im Ausland direkt bei Nokia eingekauft, da für Handys in der Bundesrepublik seinerzeit noch die Zulassung fehlte. 2.800 DM hatte Brandt für seinen mobilen Begleiter bezahlt. Ein sensationell niedriger Preis, kosteten doch die sperrigen Autotelefone für das Vorläufernetz, das damalige analoge C-Funknetz der Bundespost, noch rund 10.000 DM. Dennoch: Für das neuartige Mobiltelefon musste man im Vergleich eines jetzt aktuellen Smartphones eine stolze Kaufsumme hinblättern. Für Günter Brandt hatte Erreichbarkeit oberste Priorität. Als Headhunter musste der heute 64-Jährige auf seinen Reisen durch die ganze Republik mobil ansprechbar sein.
Doch was tun, wenn zwar das Gerät für den neuartigen Mobilfunk vorhanden ist, aber eine Netzkarte fehlt? Günter Brandt wusste einen Ausweg. Über seine Kontakte zu Mannesmann sprach er auf der Messe CeBIT den damaligen Vertriebschef und späteren Unternehmenslenker Jürgen von Kuczkowski an. „Ich sagte ihm, dass mich mein großer C-Netz-Telefonapparat im Kofferraum stört. Daraufhin bot er mir spontan einen Vertrag für eine damals ganz neue Technik an”, erinnert sich Brandt.
Das neue Telefon hatte Brandt mit der Karte nun komplettiert: Jetzt erlebte er den kommenden Mobilfunkalltag hautnah. Unzählige Male informierte er die Polizei sofort über Unfälle und spielende Kinder auf den Autobahnen und rief so schnelle Hilfe herbei. Auch ermöglichte er bei Autobahn-Vollsperrungen anderen „Stauopfern”, die damals noch kein Handy hatten, wichtige Telefonate. Etliche wichtige Geschäfte wurden so über sein Handy gesichert und Liebesbeziehungen gerettet. „Es war eine Attraktion und große Hilfe, ein Autotelefon benutzen zu können”, sagt Brandt. Übrigens: Bis heute hat Günter Brand seine Rufnummer und seinen Anbieter nicht gewechselt.
Durchbruch
Mobilfunk: Aus Luxus wird Alltag
Günstiger und leistungsfähiger - Handys im Wandel
Kaum ein Gegenstand hat in den vergangenen Jahren eine derart steile Karriere hingelegt: Waren Mobiltelefone im analogen C-Netz noch Luxusgut für Schwerreiche, so wurden sie dank der Digitaltechnik der D-Netze für jedermann erschwinglich und so selbstverständlich wie ein Kuli oder Taschenrechner. Das Handy ist heute zugleich Arbeitsmittel, Freizeitspaß und nützlicher Alltagsbegleiter für die Kommunikation in der Mediengesellschaft. Das Fundament dafür sind stets weiterentwickelte und leistungsfähige Netze, rapide gesunkenen Gerätpreise und die Flatrates fürs ungestörtes Plaudern und Surfen.
Doch zurück zu den Anfängen: Die ersten D2-Telefone kosteten vor 20 Jahren noch zwischen 2.500 DM und 3.000 DM. Eine stolze Summe für damalige und heutige Verhältnisse, seinerzeit allerdings im Marktvergleich ein sensationell niedriger Preis. Denn aus dem C-Netz war man Kosten von rund 10.000 DM für Autotelefone gewohnt. Mobiles Telefonieren war im Juni 1992 identisch mit Autotelefon und angesichts der Einstiegspreise und der hohen monatlichen „Grundgebühren” im C-Netz nur für gut betuchte Kreise finanzierbar. Dann kam mit GSM das D2-Netz.
Die große Vision zum Netzstart: Mobiles Telefonieren für die breite Bevölkerung erschwinglich machen! 20 Jahre später ist diese ehrgeizige Mission längst erfüllt. Mobilfunk gehört zum Alltag der Deutschen, der Europäer und verändert das Kommunikationsverhalten in vielen Ländern der Welt. Und neben den Geräten sind auch die Kosten für Gespräche und Dienste mit dem Handy seit Beginn des Mobilfunks enorm gesunken.
Vor 20 Jahren kostete eine Mobilfunkminute während des Tages 1,44 DM bei einer Monatspauschale von 77,52 DM. In der Nebenzeit, also zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr, fielen 0,49 DM pro Minute an. Das änderte sich grundlegend im Laufe der Mobilfunkgeschichte. Schon rund 10 Jahre später kostete der D2-Fun-Tarif im monatlichen Basispreis 10,99 Euro oder umgerechnet 21,51 DM. Die Minutenpreise mussten extra beglichen werden. Heute gibt es für knapp 10 Euro den Laufzeittarif bei Vodafone inklusive Sprachflatrate ins Vodafone Netz oder in der Allnet 100 Variante mit 100 Sprachminuten in alle deutschen Netze. Und: Einfache, aber leistungsstarke Handys für den Alltagsgebrauch sind in Warenhäusern und im Multimedia-Fachhandel aktuell schon ab 29 Euro erhältlich - und das vertragsfrei ohne Bindung an ein Netz oder an eine bestimmte SIM-Karte.
Startschuss für Roaming
Aufbruch ins grenzenlose Netz
GSM ermöglichte Handy-Telefonate über Ländergrenzen
Heute gang und gäbe - 1992 ein absoluter Durchbruch: das mobile Telefonieren über nationale Ländergrenzen hinweg. 7 Monate nach dem Start von D2 öffnete das erste Roaming die nationalen Mobilfunkschranken. Bis dahin endete jedes Mobilfunkgespräch spätestens am Schlagbaum. Mehr noch: Geräte des analogen Funknetzes C wurden zum Schutz der nationalen Funklizenzen bisweilen an den Schlagbäumen zum Nachbarland verplombt. Wer im analogen Netz funkte, war national geregelt. Mit dem gemeinsamen digitalen GSM-Standard ordnete sich die Welt für die mobile Telefonie neu. Und dieses grenzlose Kommunikationsmodell eroberte mit seinem technischen Standard von Europa aus die Welt. Heute können Vodafone-Kunden auf ihren Reisen in 184 Ländern mobil telefonieren und haben weltweit 399 Netze von Roaming-Partnern zur Auswahl.
Mit Suisse PTT realisierte D2 die erste mobile Reisefreiheit. Handy-Gespräche und auch der Zugang zur Mailbox waren nun für die D2-Kunden bei ihren Reisen im Alpenland möglich. Neben den guten Verbindungen zu den Eidgenossen rückte auch der hohe Norden kommunikativ näher an Deutschland heran. Dänemark beispielsweise: Gleich 2 Anbieter ermöglichten den Kunden das Telefonieren über die Grenzen hinweg. Die Dansk Mobil Telefon und die Tele Danmark Mobil. Sie boten ein ganzes Bündel von Diensten: Telefonie, Anrufumleitung, Mailbox-Zugang und Anrufsperrung. Verbindungen nach Schweden? Auch kein Problem. Die Televerket Radio glänzte mit genau den gleichen Diensten wie das Nachbarland Dänemark. Allerdings war eine Anrufumleitung noch nicht möglich. Weiter ging es mit Finnland. Die Finnland Radiolinjia sprengte Grenzen mit den Möglichkeiten der Telefonie, Anrufumleitung, Mailbox-Zugang und Anrufsperrung.
Zur britischen Insel gab es Anfang 1993 Netz übergreifende Kommunikation, genauso wie nach Frankreich, Italien, Norwegen und Belgien. Im 2. Quartal des gleichen Jahres stießen Spanien, Portugal, Luxemburg, Österreich und Irland hinzu. Die Niederlande fand sich Ende 1993 im mobilen Bund ein.
Allerdings war das grenzenlose Gespräch damals etwas kostspieliger als heute. So kostete die Verbindung von Dänemark nach Deutschland 2,09 DM. Und heute? Der Minutenpreis beträgt im EU-Ausland knapp 35 Cent (ab 01. Juli 2012). Ankommende Telefonate kosten dann übrigens knapp 10 Cent. Insgesamt können Vodafone-Kunden auf ihren Auslandsreisen inzwischen in 184 Ländern mit ihrem Handy telefonieren. Selbst auf Reisen durch exotische Länder wie Äquatorial Guinea, Abchasien, Bhutan oder Neukaledonien sind Kunden von Vodafone Deutschland auf ihrem Handy erreichbar.
Nächste Generation
Das Netz macht erfinderisch
Mobilfunk macht Ampeln in Zukunft überflüssig
Die Zukunft ist das Zuhause von morgen: Forscher entwickeln bereits die Szenarien der nächsten, der 5. Mobilfunk-Generation. Das Erleben von Live-Konzert-Mitschnitten auf mobilen Geräten in Echtzeit, die Perspektive eines Lieblingsspiels bei einem heißen Fußballderby auf dem Platz, die Vermeidung von Unfällen durch intelligente und rasant schnelle Mobilfunktechnik. Für Gerhard Fettweis, Inhaber des Vodafone-Stiftungslehrstuhls an der TU-Dresden, sind das keine Fantastereien. Die Weiterentwicklung von LTE (Long Term Evolution), dem jüngsten Standard zur Übertragung von digitalen Daten per Mobilfunk, wird seiner Meinung nach den Alltag eines jeden Menschen ändern.
„Bisher sind die nutzbaren Datenraten etwa alle 5 Jahre um den Faktor 10 gestiegen. Die Rechenleistung in den verfügbaren Mikroprozessoren hat sich sehr ähnlich entwickelt”, sagt Fettweis. Und diese Turbogeschwindigkeit stoße die Tür zu ganz neuen Möglichkeiten auf. Fahrzeuge würden etwa über Mobilfunk kommunizieren. Die Technik würde zur Kontrollinstanz oder könne den Fahrer gar ganz ersetzen, sagt der international renommierte Mobilfunk-Forscher. Das Resultat: Es entstünde ein ganz neuer Freiraum für die Stadtplanung, da bislang notwendige Ampelanlagen entfielen.
Die 5. Mobilfunkgeneration könne bis zu tausendmal so schnell werden wie die aktuelle Hochgeschwindigkeitstechnik LTE. Reaktionszeiten innerhalb der Mobil-zu-mobil-Kommunikation schrumpften auf eine Millisekunde. Möglich werde das durch den Ausbau der Basisstationen mit weiteren Antennen und die Unterteilung der Funkzellen in mehr Sektoren. Hinzu käme eine Kommunikation der Basisstationen untereinander. Mit dem Prinzip des „Multiple Input, Multiple Output” - oder auch kurz MIMO-Technik ist eine Vervielfachung der Datenrate möglich, wie der Forscher sagt. Dies sei in der Evolution der Netze bis heute stets so gewesen. „Noch vor Kurzem hätte sich niemand vorstellen können, seine Fotos und Videos jederzeit von unterwegs zu verschicken. Heute ist das bereits Realität.”
Dabei zeigt bereits der Blick auf die aktuelle, die 4. Netzgeneration, das gewaltige Potenzial des schnellen mobilen Internetzugangs: Der Daten- und Programmspeicher in der Wolke wird Türöffner für das mobile Büro, Autos erhalten automatische Notrufsysteme, fernauslesbare Zähler senken den Energiebedarf und es wächst ein Internet der Dinge. Jedes Gebrauchsgut mit Datenchip kann sich darin vernetzen und Informationen tauschen. Mein Wecker zeigt mir dann Wetterdaten und Verkehrslage, klingelt nötigenfalls etwas früher, schaltet aber auch die Klimaanlage des Autos in den Wohlfühlbereich.
LTE ist noch eine junge Technik: Bei Vodafone startete der Netzausbau im Herbst 2010. Bereits innerhalb weniger Monate wurde der Großteil der ländlichen Regionen, die zuvor kein Breitband-Internet hatten, dank LTE an die Datenautobahn angebunden. Weiteres Wachstumspotenzial für LTE bieten die Städte. Nach Düsseldorf bringt Vodafone in den kommenden Monaten Dresden, Leipzig, Dortmund sowie viele weitere Großstädte ans LTE-Netz. In Berlin, München und Hannover profitieren Bewohner und Besucher bereits in weiten Teilen durch die Versorgung mit LTE. Die breite Basis für viele Neuerungen wächst rasant.
 |
 |
 |
 |
| 1992 Motorola International 1000 Das „Porty” ist meistens in Autos eingebaut. |
1993 Ericsson GH 172 Das erste D2 Privat-Handy, mit dem Mannesmann Mobilfunk die kommerzielle Vermarktung startete. Zuerst ist nur SMS-Empfang möglich. |
1994 Motorola International 3200 Der „Knochen” wiegt über 500 Gramm und misst fast 20 Zentimeter. |
1994 Motorola International 3200 Seitenansicht |
 |
 |
 |
 |
| 1995 Nokia 2110 Mit dem „Volkshandy” begann der Siegeszug von SMS. |
1995 Siemens Handy |
1995 Siemens Handy |
1995 Siemens Handy, Antenne ausgezogen |
 |
 |
 |
 |
| 1995 Nokia Handy |
1995 Nokia Handy mit ausgezogener Antenne |
1999 Nokia 7110 Eines der ersten WAP-fähigen Handys, die das Internet mobil machen |
1999 Nokia 7110 - offen |
 |
 |
 |
 |
| 2002 Sharp GX 10 Das erste Handy mit dem Dienst Vodafone live!, dem mobilen Nachrichten- und Unterhaltungsportal |
2002 Sharp GX 10 aufgeklappt |
2002 Sony Ericsson Z1010 Das erste UMTS-fähige Handy im Vodafone-Portfolio |
2002 Sony Ericsson Z1010 - aufgeklappt |
 |
 |
 |
 |
| 2007 iPhone 2G Das erste Smartphone mit Internet-Browser |
2007 Samsung P1 |
2012 HTC Velocity 4G Das erste LTE-fähige Smartphone |
2012 HTC Velocity 4G |
Quelle und Fotos: Vodafone
Deutsche Telekom: 20 Jahre Mobilfunk
Von 1992 bis 2012 - Die Meilensteine
30. Juni 2012
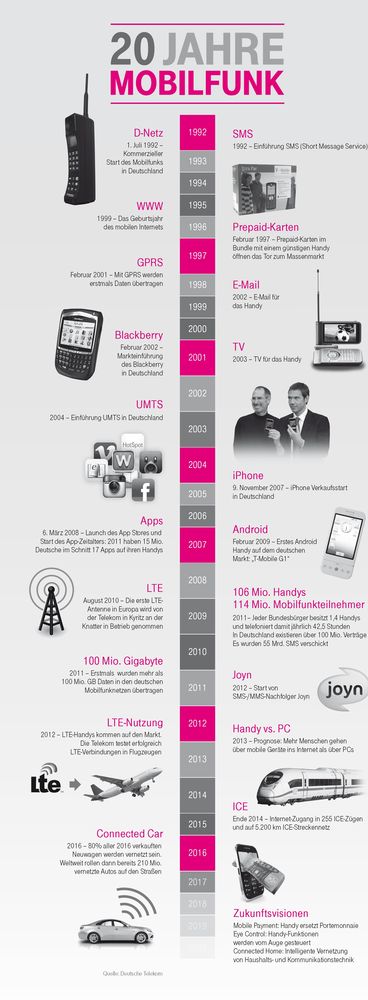
© Deutsche Telekom AG
vergrößern (PDF)
D-Netz läutet Mobilfunkzeitalter ein
Viele können sich heutzutage ein Leben ohne Handy nicht mehr vorstellen. Das kleine Technik-Wunder ist längst mehr als nur ein Telefon. Es erfüllt viele verschiedene Funktionen gleichzeitig und ist dadurch zu unserem ständigen Begleiter geworden. Kaum vorstellbar, dass vor 20 Jahren nur ein Bruchteil der deutschen Bevölkerung im Besitz eines Mobiltelefons war. Dies änderte sich mit der kommerziellen Einführung des D-Netzes am 1. Juli 1992. Das D-Netz löste seine Vorgänger A-, B- und C-Netz ab und läutete die 2. Generation der Mobiltelefonie ein. Das D-Netz machte die mobile Kommunikation massenmarktfähig. Die dazu benötigten Endgeräte kosteten damals jedoch noch ein kleines Vermögen. Rund 3.000 DM musste man für ein Mobiltelefon bezahlen. Zum Vergleich: Im Durchschnitt verdiente ein Arbeitnehmer 1992 in Deutschland im Jahr 46.820 DM. Dank der sich immer weiterentwickelnden Technik und der steigenden Nachfrage an Mobilfunkgeräten, wurden diese aber bereits Mitte der 1990er Jahre immer günstiger.
SMS, günstige Tarife und Prepaid-Karten
Der nächste Meilenstein in der mobilen Telefonie war der Short Message Service, kurz SMS. Die digitale Übertragung von Textbotschaften wurde in Deutschland 1994 eingeführt und entwickelte sich in kurzer Zeit zum meistgenutzten Handy-Dienst nach dem Telefonieren. Die Mobilfunkpreise sanken 1996 spürbar. Die Grundgebühr fiel von 50 DM auf knapp 30 DM. Im folgenden Jahr wurden die Guthabenkarten (Prepaid-Cards) eingeführt.
GPRS und UMTS
Nach der Sprache wurden die Daten mobil. Der General Packet Radio Service - GPRS - gleicht der Übertragungstechnik im Internet. Die Technik ist die Grundlage für alle über das Telefonieren hinausgehenden Nutzungsmöglichkeiten des Handys und wird nach wie vor für viele Anwendungen genutzt. 2004 wurde GPRS teilweise von UMTS abgelöst. Das Universal Mobile Telecommunications System ist der aktuelle Standard zur Übertragung von Daten über Mobilfunknetze und wird als 3. Mobilfunkgeneration (3G) bezeichnet. Die UMTS-Technik bietet neben der Telefonie auch die Möglichkeit, unterschiedlichste Multimedia- und Datendienste in Anspruch zu nehmen. Hierzu zählen neben der Benutzung des Internets auch Videostreaming oder Videotelefonie.
World Wide Web - das Internet revolutioniert den Mobilfunk
Im Jahr 1999 wurde das Internet mobil. Mithilfe der WAP-Technologie (Wireless Application Protocol) wurden die Inhalte des Internets für den Empfang auf Mobiltelefonen angepasst. Damals lief die Datenübertragung allerdings noch sehr langsam und die Inhalte mussten komprimiert werden. Der Nutzer fand auf dem Mobiltelefon also nur eine reduzierte Version des übertragenen Inhalts wieder. Das mobile Internet machte es 2002 möglich, E-Mails auf dem Handy zu empfangen und bereits ein Jahr später konnten entsprechende Handys auch zum Empfang von Fernsehsendungen genutzt werden. 2008 besaßen laut der Studie „Mobile Web Watch” bereits 62 Prozent der Deutschen ein internetfähiges Handy.
Smartphones auf dem Vormarsch
1998 kamen mit der Modellserie Communicator von Nokia die ersten Smartphones auf den Markt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Mobiltelefonen sind Smartphones in Konstruktion und Bedienung nicht nur für das Telefonieren optimiert, sondern ermöglichen die komfortable Nutzung einer ganzen Reihe von Anwendungen. Typische Merkmale sind bis heute große und hochauflösende Bildschirme, alphanumerische Tastaturen und Touchscreens. Diese Eigenschaften der „intelligenten” Telefone dienen vor allem der Nutzung des mobilen Internets.
Im Februar 2002 kam in Deutschland der Blackberry auf den Markt. Ein Mobiltelefon, das speziell zum Lesen und Schreiben von E-Mails entwickelt wurde. Schon bald wurde der Blackberry zum unverzichtbaren Accessoire für Geschäftsleute.
Einen weiteren Meilenstein in der Smartphone-Technologie setzte Apple im Jahr 2007 mit dem iPhone. Das Gerät bestach durch seine unkomplizierte Bedienbarkeit - mobiles Surfen war kein Hexenwerk mehr.
2009 brachte der Suchmaschinen-Gigant Google mit dem T-Mobile G1 sein erstes Handy mit dem Betriebssystem Android auf den Markt.

T-Mobile G1 / Foto: T-Mobile
Allen 3 Geräten, Blackberry, iPhone und Android-Handy, war eines gemeinsam, sie wurden von der Telekom auf dem deutschen Markt eingeführt. Seither sind Smartphones auf dem Vormarsch: 2010 machten sie mit 7,4 Millionen abgesetzten Geräten bereits 37,8 Prozent des gesamten Handymarktes aus. 2011 besaß bereits jeder 3. Deutsche ein Smartphone.
Apps erobern den Mobilfunkmarkt
Apps gibt es eigentlich schon solange es Mobiltelefone gibt. Sie bezeichnen Anwendungen auf dem Handy wie beispielsweise Wecker, Kalender oder Spiele. Nach dem der iPhone App Store 2008 seine Pforten öffnete, erfuhren Apps einen nicht vorhergesehenen Boom. Apps geben dem Nutzer die Möglichkeit, das eigene Handy ganz nach seinen persönlichen Bedürfnissen zu erweitern. In Deutschland nutzen über 10 Millionen Bundesbürger Apps auf ihrem Handy. Handynutzer zwischen 14 und 29 Jahren haben im Schnitt 22 Anwendungen installiert.

LTE: noch schnelleres Internet für das Handy
Die Telekom hat im Sommer 2010 in Kyritz an der Knatter den ersten LTE-Sendemasten in Europa in Betrieb genommen. LTE steht für Long Term Evolution, die 4. Mobilfunkgeneration. Mithilfe von LTE ist es gelungen schnelles Internet auch in solche Gebiete zu bringen, die mit Festnetzanschlüssen nicht ausreichend versorgt werden konnten. Darüber hinaus bietet LTE die Möglichkeit, Daten mit bis zu 100 Megabit pro Sekunden über die Luftschnittstelle zu versenden. Derzeit wird LTE auch in Flugzeugen getestet: in naher Zukunft sollen Fluggäste über Wlan auf das Bordnetz zugreifen und ganz normal surfen können. Zum Flugzeug gelangen die Daten aber nicht wie bislang über Satelliten, sondern über angepasste LTE-Bodenstationen.
Connected Car, Connected Home: Die Zukunft ist vernetzt
Elektronische Geräte, die wir im Haushalt, unterwegs oder im Büro nutzen, besitzen immer öfter eine Schnittstelle zum Internet. Deshalb können sie auf intelligente Weise miteinander verknüpft werden. Schon heute lassen sich Festplattenrekorder beispielsweise über ein Smartphone steuern und Aufnahmen programmieren, obwohl man vielleicht gerade hunderte Kilometer von Zuhause entfernt ist. In den nächsten Jahren werden Angebote dieser Art sprunghaft ansteigen und unser Leben bequemer und einfacher machen. Neben dem Haus wird in Zukunft auch das Auto vernetzt sein. So werden künftige Technologien, Apps und Services für die Weiterentwicklung von Sicherheit, Komfort, Kommunikation und Entertainment im Auto sorgen. Im Jahr 2016 sollen bereits 80 Prozent der global verkauften Autos vernetzt sein. Es werden dann weltweit 210 Millionen vernetzte Wagen auf den Straßen rollen.
Zukunftsvisionen
Die Zukunft des Mobilfunks wird noch einige Überraschungen bereithalten, denn eines steht fest: die Entwicklung ist noch lange nicht am Ende. Mobile Services und Anwendungen für das Handy wie beispielsweise Mobile Payment (Bezahlung per Handy) oder Eye Control (das menschliche Auge steuert Handy-Funktionen) sind schon in den Startlöchern und bieten ganz neue Möglichkeiten in der Mobilfunk-Nutzung.
20 Jahre Mobilfunk - Wo geht die Reise hin?
Gesundheit
E-Health-Lösungen sorgen dafür, dass sich Krankenkassen, Kliniken, Ärzte und Patienten sicher vernetzen. Patienten bringt dies eine bessere Versorgung. Gleichzeitig bieten sich Chancen für den dringend benötigten Umbau unserer Gesundheitssysteme, damit die Kosten nicht immer neue Rekorde erreichen. Die Ausgaben im deutschen Gesundheitswesen sind in den letzten 10 Jahren um mehr als 30 Prozent gestiegen und haben die Höhe von 287 Milliarden Euro erreicht. Zudem wird es aufgrund der demografischen Entwicklung immer mehr Leistungsempfänger und immer weniger Beitragszahler geben. Das Gesundheitswesen muss darauf reagieren und neue Prozesse und Strukturen entwickeln. Ein Weg liegt in der besseren Vernetzung aller Akteure im Gesundheitswesen auf Basis moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT).
In Friedrichshafen erproben Ärzte mit Hilfe der Telekom beispielsweise das Diabetes-Management-System GlucoTel. Die Lösung überträgt Zuckerwerte vom Messgerät der Patienten per Bluetooth an das Handy des Patienten und von dort automatisch in ein Online-Tagebuch. Das Portal verfügt über die gleichen Sicherheitsstandards wie im Online-Banking. Ein weiterer Trend ist der Einsatz von Tablets in Kliniken. Ärzte greifen über die handlichen Kleincomputer direkt am Krankenbett auf die im Kliniksystem hinterlegten Befunde oder Röntgenbilder zu. Sie haben somit stets einen aktuellen Überblick über alle Informationen zu ihren Patienten. Gegenwärtig erprobt die Berliner Charité die Technologie gemeinsam mit der Telekom und SAP. Mit Erfolg: Viele Ärzte kennen die neuen Tablets privat und haben darauf gewartet, deren Vorteile auch beruflich zu nutzen. Ebenso die Patienten: Weil der Arzt stets alle Daten dabei hat und Bilder etwa sofort zeigen kann, verstehen sie die medizinische Behandlung besser als zuvor.
Auto
Das Internet drängt mit großer Macht ins Auto und mit ihm jede Menge Daten, Dienste und Applikationen. Das Auto entwickelt sich zu einem vernetzen Endgerät und wird zum rollenden Büro. Bei allen Entwicklungen hat die Sicherheit Vorfahrt. Damit Internet und Miniprogramme auch während der Fahrt stets zur Verfügung stehen, kombiniert die Telekom verschiedene Techniken so, dass der Bordcomputer stets Empfang hat. Dazu gehören Übertragungskanäle wie UMTS, HSDPA und GPRS. Gemeinsam mit BMW stellt die Deutsche Telekom den Telematik-Dienst „Connected Drive” zur Verfügung. Allen Fahrzeugklassen des Münchner Autobauers werden ein mitdenkendes Wartungssystem, erweiterte Verkehrsinfos, einen automatischen Notruf oder Google-Dienste angeboten. T-Systems und Continental entwickeln seit 2009 ein Multimediasystem, das Navigation, Internet- und Online-Dienste zusammenführt.
Energie
Klimawandel und endliche Ressourcen mahnen, erneuerbare Energien zu nutzen. Die Europäische Union fordert deshalb bis 2020 einen Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch von 20 Prozent. Um dieses Ziel zu erreichen, garantiert die Bundesregierung etwa eine Einspeisevergütung für Solarstrom. Derzeit liefern Photovoltaik-Anlagen in Deutschland bis zu 25 Gigawatt Strom. Das entspricht etwa der Leistung von 25 Kernkraftwerken. Diese Strommenge ist nur schlecht kalkulierbar, da die Sonne nicht immer scheint. Darüber hinaus kann das Stromnetz keine Energie speichern, die Energieversorger müssen aber den zusätzlichen Strom abnehmen. Dies bringt das Stromnetz zunehmend aus dem Takt - es droht der Ausfall. Die sichere Versorgung aus erneuerbaren Ressourcen kann langfristig nur ein Stromnetz gewährleisten, das sich selbst steuert.
Die Rede ist vom sogenannten Smart Grid, das mit Hilfe von IT und Telekommunikation gemanagt wird. Voraussetzung dafür ist das Wissen, welche Strommenge wann und wo eingespeist und entnommen wird. Dies umfasst sowohl die Wirtschaft als auch die Privathaushalte. Konsumenten werden zu Produzenten, der Anteil erneuerbarer Energien steigt und die Steuerung des Energienetzes wird zur Denksportaufgabe. Smart Grids helfen auf die Sprünge. Elektronische Zähler sind die Basis für dieses intelligente Netz. Denn sie stellen die Transparenz her. Als Partner der Energiewirtschaft installiert die Telekom die neuen Zähler sowie zentrale Kommunikationsboxen. Damit werden Verbrauchsdaten ausgelesen, übertragen und verarbeitet. So bietet die Telekom Infrastruktur und Software für die Geschäftsprozesse der Energiewirtschaft als Cloud Computing an. Die gesamte ICT-Unterstützung für diese Prozesse kommt damit aus der Wolke - mit über 1.600 Einzelbausteinen. Erfahrungen aus Pilotprojekten zeigen, dass Haushalte dank aktueller Verbrauchsdaten Stromfresser identifizieren, ihr Verhalten ändern und so rund 5 Prozent Strom und damit Kosten sparen. So profitieren Umwelt, Wirtschaft und Endverbraucher von „smarter” ICT.
Geld
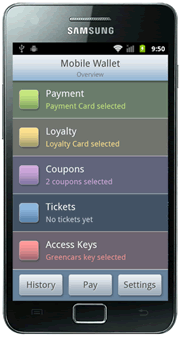 Die Nutzung von mobilen Geräten für Zahlungsdienste- und Berechtigungsmanagement ist ein wichtiger Trend im Mobilfunk. In vielen Ländern laufen entsprechende Projekte. Studien prognostizieren alleine für mobile Zahlungsdienste gut 2 Milliarden weltweite Nutzer im Jahr 2013. Eine Basis für derartige Mehrwertdienste bietet die Universal lntegrated Circuit Card (UICC), die als nächste Generation der SIM-Karte nicht nur deren Funktion für mobile Kommunikation unterstützt, sondern als Plattform zugleich die Integration einer Vielzahl von Sicherheitsanwendungen Dritter erlaubt. Auf dieser Grundlage ist in den Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) ein Rahmen für Lösungen entwickelt worden, der das Handy in Kombination mit der Near Field Communication-Technologie (NFC) befähigt, mobile Zahlungs- und Identitätsmanagement-Funktionalitäten zu beherbergen. mWallet eröffnet Möglichkeiten, Dienste in Bereichen wie Zahlung, Tickets, Bonusprogramme oder Zugangskarten in der realen Welt sowie im Internet einheitlich und sicher zu realisieren. Das in den T-Labs entwickelte mWallet macht das Telefon zur Geldbörse, die einfach zu bedienen und sicher zu nutzen ist. Die Benutzungsoberfläche ist analog zu einer physischen Brieftasche mit einer Vielzahl unterschiedlicher Karten gestaltet, die die verschiedenen Zahlungs- und Authentifizierungsdienste im mWallet repräsentieren.
Die Nutzung von mobilen Geräten für Zahlungsdienste- und Berechtigungsmanagement ist ein wichtiger Trend im Mobilfunk. In vielen Ländern laufen entsprechende Projekte. Studien prognostizieren alleine für mobile Zahlungsdienste gut 2 Milliarden weltweite Nutzer im Jahr 2013. Eine Basis für derartige Mehrwertdienste bietet die Universal lntegrated Circuit Card (UICC), die als nächste Generation der SIM-Karte nicht nur deren Funktion für mobile Kommunikation unterstützt, sondern als Plattform zugleich die Integration einer Vielzahl von Sicherheitsanwendungen Dritter erlaubt. Auf dieser Grundlage ist in den Telekom Innovation Laboratories (T-Labs) ein Rahmen für Lösungen entwickelt worden, der das Handy in Kombination mit der Near Field Communication-Technologie (NFC) befähigt, mobile Zahlungs- und Identitätsmanagement-Funktionalitäten zu beherbergen. mWallet eröffnet Möglichkeiten, Dienste in Bereichen wie Zahlung, Tickets, Bonusprogramme oder Zugangskarten in der realen Welt sowie im Internet einheitlich und sicher zu realisieren. Das in den T-Labs entwickelte mWallet macht das Telefon zur Geldbörse, die einfach zu bedienen und sicher zu nutzen ist. Die Benutzungsoberfläche ist analog zu einer physischen Brieftasche mit einer Vielzahl unterschiedlicher Karten gestaltet, die die verschiedenen Zahlungs- und Authentifizierungsdienste im mWallet repräsentieren.

Quelle: Deutsche Telekom AG
„Ich sehe was, was Du nicht siehst”
QR-Code: ein gerastertes Quadrat
2012
Per kostenloser App können Smartphones über ihre Kameraoptik diesen QR-Code entschlüsseln. Dieser enthält beispielsweise einen Teil des nachfolgenden Textes.
Der alte Kinderspruch kommt zu neuen Ehren, seitdem sich immer mehr Handys als Alleskönner in den schnellen Mobilfunknetzen tummeln.

Per kostenloser App können Smartphones über ihre Kameraoptik
diesen QR-Code entschlüsseln.
Dieser enthält beispielsweise einen Teil des nachfolgenden Textes.
Grafik: Deutsche Telekom AG
E-Mail statt Brief, Internetbanner statt Anzeige, QR-Code statt Video-URL: Das papierlose Büro gibt es trotzdem noch nicht. Im Gegenteil: Druckmedien erleben eine gewisse Renaissance, weil sie sich durch die Integration digitaler Medien wirkungsvoll aufwerten lassen. Ein Grund sind die sogenannten Quick Response-Codes (QR) und Augmented Reality (AR, „erweiterte Realität”).
Die kostenlose App und eine Autofokus-Linse vorausgesetzt, sind „QR” und „AR” für Smartphones wahre Fundgruben. Immerhin gehören die Schweizer Messer unter den Handys mittlerweile zur Grundausstattung der jungen Generation. Sie sind die Kommunikationsmittel der Zukunft. In Beruf und Freizeit bestimmen sie den Alltag.
Alle setzen auf gerasterte Quadrate
Seit einigen Jahren finden QR-Codes Verbreitung. Über die schwarz-weiß gerasterten Quadrate verlinken Printmedien auf Animationen, Fotos, Videos oder andere Zusatz-Informationen. Scannt der Leser mit seinem Smartphone etwa den QR-Code eines Werbeplakats ab, verbindet es sich automatisch mit einer speziellen Internetseite und führt den Leser zu weiteren, idealerweise nützlichen Informationen. So kann etwa auf Werbeplakaten die gesamte Vielfalt der technischen Informationen zum beworbenen Produkt transportiert werden.
Ein Handy hat Mehrwert
QR-Codes bieten sich auch zum Einsatz in Mailings, auf Einladungen oder in Anzeigen an. Überall dort, wo weiterführende Informationen nicht untergebracht werden können oder sollen, bieten QR-Codes vielfältige Möglichkeiten für einen Mehrwert. Bei der Nutzung von „Augmented Reality” steht man zwar noch am Anfang, doch eröffnen AR-Anwendungen Nutzern wie Anbietern nahezu unbegrenzte Möglichkeiten in der Kommunikation.
Nur das Bild zählt
Hierfür ist nämlich kein sichtbares Code-Quadrat als Marker notwendig. Vielmehr können beliebige Fotos und Grafiken in visuellen Medien als Marker definiert werden. Auf dem Smartphone wird dann eine Videosequenz, Animation oder eine Präsentation gezeigt, die sich über den abgefilmten, realen Hintergrund legt. Durch drehen des Smartphones sind außerdem effektvolle 3-D-Visualisierungen möglich, beispielsweise Produktanimationen oder Filmtrailer. Der Smartphone-User benötigt für AR neben einer eingebauten Autofokus-Kamera lediglich eine kostenlose Applikation, die sich im gewohnten App-Store herunterladen läßt.
Quelle Deutsche Telekom AG
Faszinierend und innovativ: Wie M2M die Welt verändert
11.09.2012
Wir lassen uns vom Smartphone den Weg zeigen, anstatt uns mit faltbaren Straßenkarten herumzuschlagen. Wir bestellen unser Taxi auf Knopfdruck per App. Die technische Entwicklung der letzten Jahre hat unser Leben bequemer gemacht. Auch M2M vereinfacht unseren Alltag zunehmend. Und das still und heimlich im Hintergrund. Doch was bedeutet M2M und wie funktioniert diese „unsichtbare” Technologie?
Nähern wir uns M2M erst mal auf der begrifflichen Ebene
Wikipedia schreibt: „Machine-to-Machine (kurz M2M) steht für den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Containern untereinander oder mit einer zentralen Leitstelle. Eine Anwendung ist die Fernüberwachung, -kontrolle und -wartung von Maschinen, Anlagen und Systemen, die traditionell als Telemetrie&xnbsp;bezeichnet wird. Die M2M-Technologie verknüpft dabei&xnbsp;Informations- und Kommunikationstechnik.”
Soweit so gut. Aber was bedeutet M2M in der Praxis?
Transport-Unternehmen nutzen M2M zum Beispiel, um ihren Fuhrpark zu überwachen und die Routen ihrer Lastwagen zu planen und besser kontrollieren zu können. Damit stellen sie sicher, dass die Ladung rund um die Uhr überwacht wird. Natürlich lassen sich auch andere Dinge mit der M2M Technologie überwachen. Beispielsweise gefräßige Nager. So hat M2M-PLUS, die Produktmarke der E-Plus Gruppe, gemeinsam mit den Partnern BioTec-Klute und BSC Computer ein wirklich ungewöhnliches M2M-Konzept entwickelt: eine kommunizierende Mausefalle, die simst und mailt, und so die entsprechende Stelle darüber informiert, dass sie zugeschnappt ist und gelehrt werden möchte.
M2M überwacht Mäuse. Und was noch?
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Was M2M noch alles kann, erklärt Ulrich Coenen, Chief Innovation Officer der E-Plus Gruppe, im Artikel „Internet der Dinge oder: Das ewige Gleichnis vom schlauen Kühlschrank” auf UDL Digital. Auf dem Digital Public Affairs Blog der E-Plus Gruppe berichtet er regelmäßig von Innovationen aus der digitalen Welt.
Quelle: E-Plus Gruppe
Vor 50 Jahren startete das Satellitenfernsehen
08.07.2012
- Erster Satellit Telstar 1 nahm im Juli 1962 den Betrieb auf.
- 17 Millionen Deutsche empfangen Fernsehen per Satelliten.
- Mehr als 100.000 Bundesbürger gehen per Satellit ins Internet.
 Vor 50 Jahren begann die Ära der Satellitenkommunikation: Am 10. Juli 1962 schoss die NASA in Cape Canaveral den ersten aktiven Kommunikationssatelliten ins All. Dank Telstar 1 konnte Ende Juli 1962 erstmals Live-Fernsehen zwischen Amerika und Europa übertragen werden. Dieser erste Kommunikationssatellit war allerdings nur 226 Tage aktiv. Durch einen außeratmosphärischen Atombombenversuch der USA wurde er so stark beschädigt, dass er im Februar 1963 komplett ausfiel. Trotzdem steht er bis heute für den Beginn der Satelliten-Ära. „Der Start von Telstar 1 stellt einen Meilenstein dar. Durch die Satellitentechnologie wurde es möglich, weltweit Fernsehbilder in Echtzeit zu übertragen”, sagte BITKOM-Präsident Prof. Kempf. Seitdem hat sich die Satelliten-Technologie zu einem großen Erfolg entwickelt: Nach aktuellen Schätzungen sind derzeit knapp 1.000 Satelliten im Einsatz. Ihr Vorteil: Sie ermöglichen Fernsehempfang und Internetzugang auch an Orten ohne Festnetz- oder Mobilfunkzugang.
Vor 50 Jahren begann die Ära der Satellitenkommunikation: Am 10. Juli 1962 schoss die NASA in Cape Canaveral den ersten aktiven Kommunikationssatelliten ins All. Dank Telstar 1 konnte Ende Juli 1962 erstmals Live-Fernsehen zwischen Amerika und Europa übertragen werden. Dieser erste Kommunikationssatellit war allerdings nur 226 Tage aktiv. Durch einen außeratmosphärischen Atombombenversuch der USA wurde er so stark beschädigt, dass er im Februar 1963 komplett ausfiel. Trotzdem steht er bis heute für den Beginn der Satelliten-Ära. „Der Start von Telstar 1 stellt einen Meilenstein dar. Durch die Satellitentechnologie wurde es möglich, weltweit Fernsehbilder in Echtzeit zu übertragen”, sagte BITKOM-Präsident Prof. Kempf. Seitdem hat sich die Satelliten-Technologie zu einem großen Erfolg entwickelt: Nach aktuellen Schätzungen sind derzeit knapp 1.000 Satelliten im Einsatz. Ihr Vorteil: Sie ermöglichen Fernsehempfang und Internetzugang auch an Orten ohne Festnetz- oder Mobilfunkzugang.
Kommunikationssatelliten haben die Verbreitung des Fernsehens stark vorangetrieben. Mittlerweile kann ein Satellit bis zu 500 Fernsehkanäle gleichzeitig übertragen. Zum Vergleich: Die Übertragungskapazität von Telstar 1 lag 1962 bei 1 Fernsehkanal. Auch in Deutschland ist der Fernsehempfang per Satellit weit verbreitet: Insgesamt empfangen mehr als 17 Millionen Deutsche Fernsehen per Satellit. Dabei ist das Signal nicht mehr mit dem von Telstar 1 vergleichbar. Am 30. April 2012 wurde der analoge TV-Empfang über Satellit abgeschaltet. Seitdem sind nur noch digitale Kanäle per Satellit in Deutschland zu empfangen.
Auch als Zugang zum Internet werden Satellitenverbindungen genutzt. Etwa 35.000 Haushalte werden nach Angaben der Bundesnetzagentur derzeit per Satellit mit Internet versorgt, mehr als 100.000 Bundesbürger kommen per Satellit ins World Wide Web. Insbesondere in entlegenen Regionen, die nur schwer mit Festnetz oder Mobilfunk erreicht werden können, bietet die Satellitentechnologie eine leistungsfähige Alternative. Der Internetzugang per Satellit bietet dabei Bandbreiten von bis zu 10 Mbit/s, die ab 40 Euro pro Monat zu haben sind. Ein Anschluss mit 6 Mbit/s ist bereits ab 30 Euro erhältlich. Kempf: „Internet via Satellit ist eine interessante Reservetechnologie für die letzten verbliebenen weißen Flecken auf der Breitbandlandkarte, die auch mit der neuen Technologie LTE kurzfristig nicht erschlossen werden können.”
Quelle: BITKOM
Beste Bildqualität für Flachbildfernseher
28.08.2012
- 78 Prozent der Haushalte verfügen über einen Flachbildfernseher.
- Tipps für den Empfang von HDTV
 Der Boom bei Flachbildfernsehern geht weiter. Anfang 2012 standen in 4 von 5 Haushalten (78 Prozent) Flat-TVs. Bis 2016 soll der Anteil nach BITKOM-Berechnungen auf 98 Prozent steigen. Einer der Hauptgründe für die Beliebtheit ist die hohe Bildqualität. „Flachbildfernseher bieten durch ihre hohe Auflösung besonders scharfe Bilder”, sagt Michael Schidlack, TV-Experte beim BITKOM. „Was viele Nutzer nicht wissen: Um die beste Bildqualität zu erhalten, braucht der Fernseher Videos in hoher Auflösung”. Doch nicht jeder Fernsehanschluss überträgt TV-Bilder in hoher Auflösung, dem sogenannten HDTV. Mit dem „Überall-Fernsehen” per Antenne kann derzeit noch kein HD-Fernsehsignal in Deutschland empfangen werden. Auch auf die richtige Verbindung zwischen Fernseher und dem TV-Empfänger oder Blu-ray-Spieler muss geachtet werden. Hierfür müssen sogenannte HDMI-Kabel eingesetzt werden. Sie sind erforderlich, um digitale Videosignale in hohen Auflösungen zu übertragen.
Der Boom bei Flachbildfernsehern geht weiter. Anfang 2012 standen in 4 von 5 Haushalten (78 Prozent) Flat-TVs. Bis 2016 soll der Anteil nach BITKOM-Berechnungen auf 98 Prozent steigen. Einer der Hauptgründe für die Beliebtheit ist die hohe Bildqualität. „Flachbildfernseher bieten durch ihre hohe Auflösung besonders scharfe Bilder”, sagt Michael Schidlack, TV-Experte beim BITKOM. „Was viele Nutzer nicht wissen: Um die beste Bildqualität zu erhalten, braucht der Fernseher Videos in hoher Auflösung”. Doch nicht jeder Fernsehanschluss überträgt TV-Bilder in hoher Auflösung, dem sogenannten HDTV. Mit dem „Überall-Fernsehen” per Antenne kann derzeit noch kein HD-Fernsehsignal in Deutschland empfangen werden. Auch auf die richtige Verbindung zwischen Fernseher und dem TV-Empfänger oder Blu-ray-Spieler muss geachtet werden. Hierfür müssen sogenannte HDMI-Kabel eingesetzt werden. Sie sind erforderlich, um digitale Videosignale in hohen Auflösungen zu übertragen.
BITKOM gibt Tipps, wie Filme in hoher Auflösung in optimaler Qualität auf dem Fernseher gezeigt werden können:
Empfangswege für HD-Fernsehen
Fernsehprogramme in hoher Auflösung gibt es ausschließlich über digitale TV-Anschlüsse. Dazu gehören digitales Satellitenfernsehen (DVB-S), digitales Kabelfernsehen (DVB-C) und internetbasierte TV-Anschlüsse (IPTV). Über einen digitalen Antennenanschluss (DVB-T) oder analogen Kabelanschluss können hingegen keine HD-Fernsehsignale empfangen werden.
HD-taugliche Empfänger
Damit der Fernseher die per Satellit oder Kabel ankommenden HD-Signale auch verarbeiten kann, braucht man zunächst einen HDTV-tauglichen Empfänger. Der kann entweder bereits in das TV-Gerät eingebaut sein oder als eigenständiges Gerät mit dem Fernseher verbunden werden. Dadurch können auch ältere Flachbildfernseher für den Empfang von Programmen in hoher Auflösung nachgerüstet werden, sofern sie das HD-ready-Logo tragen. Externe Empfänger müssen für HD-Fernsehen per HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden werden.
Privatsender verschlüsseln HD-Programme
Private Sender verschlüsseln ihr HD-Programm häufig. Um sie schauen zu können, wird ein Empfänger mit einer Schnittstelle für sogenannte CI-Module benötigt, mit denen die Fernsehsignale entschlüsselt werden. Anbieter von internetbasierenden TV-Anschlüssen liefern in der Regel einen passenden Receiver mit, der die Entschlüsselung übernimmt. Für deren Empfang ist ein solches zusätzliches CI-Modul nicht erforderlich.
Internet-TV
Öffentlich-rechtliche HD-Programme können auch über das Internet als Stream mit Diensten wie Zattoo empfangen werden. Ein Kabel- oder Satellitenanschluss ist dafür nicht notwendig. Eine schnelle Internetverbindung mit mindestens 6 Mbit/s reicht aus. Empfangsgeräte, die das Video aus dem Internet auf den Fernseher bringen, gibt es bereits im Handel. Um in den Genuss von HD-Auflösung zu kommen, muss allerdings ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden. Im Gegensatz zu IPTV-Anschlüssen ist die Bildqualität jedoch in Abhängigkeit von der jeweils aktuellen Bandbreite schwankend.
Blu-ray-Discs
Wer nicht warten möchte bis sein Lieblingsfilm im Fernsehen läuft, kann Videos in hoher Auflösungen auch auf Blu-ray-Discs kaufen oder leihen. Diese bieten neben dem Film in voller HD-Auflösung auch Kinosound und viele Extras. Die klassische DVD bietet dagegen kein HD-Bildmaterial. Zwar können einige modernen DVD-Spieler und viele Blu-ray-Player die Auflösung der DVD-Filme hochrechnen. An die Bildqualitäten von „echten” HD-Videos kommen sie jedoch nicht heran. Um die volle Auflösung des Films genießen zu können, muss der Blu-ray-Player mit einem sogenannten HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen werden.
Online-Videotheken
Filme und Serien in HD-Qualität gibt es auch in Online-Videotheken. Viele Fernseher mit Internetanschluss haben solche Dienste bereits vorinstalliert. Auch mit internetfähigen Blu-ray-Playern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen können Internet-Videotheken genutzt werden. Der große Vorteil: Filme und Serien sind jederzeit abrufbereit und nie vergriffen. Um auch Videos in hoher Auflösung über das Internet zu übertragen oder herunterzuladen, ist ein schneller Breitband-Anschluss notwendig. Empfohlen wird, um längere Ladezeiten zu vermeiden, auch bei Online-Videotheken ein Internetzugang mit mindestens 6 Mbit/s.
Quelle: BITKOM
E-Plus: Mobiles Internet per Smartphone Mobiles Internet: Wie das WWW aufs Handy kommt
25.08.2012
 Die Anfänge des Internets waren Faszination und Folter zugleich. Analoge Modems beförderten maximal 56 kbit/s. Und auch wenn Webseiten damals abgespeckter als heute daherkamen, verlief der Seitenaufbau häufig aufreizend langsam.
Die Anfänge des Internets waren Faszination und Folter zugleich. Analoge Modems beförderten maximal 56 kbit/s. Und auch wenn Webseiten damals abgespeckter als heute daherkamen, verlief der Seitenaufbau häufig aufreizend langsam.
Inzwischen sind wir verwöhnt. Das Festnetz bietet diverse DSL-Varianten, die allesamt in weiten Teilen der Republik Datenübertragungen im Mbit/s-Tempo ermöglichen. Und längst sorgen auch die Mobilfunknetze für Surfgeschwindigkeiten auf diesem Niveau. Es liegt dabei in der Natur der Zellenstruktur von Funknetzen, dass je nach Anzahl der Nutzer in einer Funkzelle sich theoretische Höchstgeschwindigkeiten im Netz allerdings mehr oder weniger stark reduzieren können. Allerdings reichen stabile 1-2 Megabit pro Sekunde für ein gutes Surferlebnis per Smartphone im mobilen Internet auf den allermeisten Seiten im Normalgebrauch locker aus.
Langer Weg durchs Netz - in Sekundenbruchteilen absolviert
Aber die Datenübertragung per Funkverbindung etwa zu einem Smartphone oder Tablet ist ja nur der letzte Schritt. Zuvor müssen die Daten aus dem Internet überhaupt erst einmal ins E-Plus Netz gelangen. Wer beispielsweise mit dem Browser auf seinem Smartphone eine Webadresse eingibt, ruft die entsprechenden Daten auf einem Server ab, der irgendwo auf der Welt steht und ans Internet angeschlossen ist. Von da nehmen die Bits nahezu per Lichtgeschwindigkeit ihren Weg durch Glasfaserleitungen - von Router zu Router. Ihr Ziel ist klar, denn die geräteeigene IP-Adresse des anfordernden Endgeräts ist ebenso bekannt wie dessen aktuelle Position.
Letztere ist eine Funkzelle im E-Plus Netz. Also suchen sich die Daten einen Übergang vom Internet in das Netz der E-Plus Gruppe. Solche Netzübergänge heißen auch Internet-Knoten oder Internet Peering Points. Die E-Plus Gruppe betreibt gleich mehrere solcher Knoten. Über diese Knoten laufen sämtliche Daten, die Kunden der E-Plus Gruppe über das Internet auf ihre Geräte laden. Die Inhalte von Webseiten gehören ebenso dazu wie zum Download aufgerufene Dateien oder der E-Mail-Verkehr.
Einmal über diese Peering Points ins E-Plus Netz gelangt, nehmen die Daten dann ihren ganz normalen Weg über die klassischen UMTS-Netz-Elemente. Zunächst über das sogenannte Transportnetz und schließlich von der Basisstation (Node B) über die Funkverbindung zum jeweiligen Endgerät. Schließlich erscheint die Webseite auf dem Display. Seit dem Aufrufen der Webadresse sind da vielleicht 1 oder 2 Sekunden vergangen. Mitunter auch weniger als 1 Sekunde.
Optimierung für die mobile Nutzung
Der Weg der Daten über das UMTS-Netz ist aber nicht das einzige, was die mobile Internet-Session von jener am heimischen PC mit DSL-Anschluss unterscheidet. Auch die übertragenen Inhalte können variieren. Wer etwa mit dem iPhone-Browser Safari www.bahn.de aufruft, wird automatisch auf mobile.bahn.de geleitet. Gegenüber der Seite, wie man sie am PC-Bildschirm sieht, ist diese mobile Version dann deutlich abgespeckt. Das funktioniert, weil die angesteuerten Web-Adressen automatisch erkennen, über welche Art Browser sie aufgerufen werden. Stammt die Anforderung von einem Smartphone-Browser, übermitteln manche Sites dann automatisch eine datenreduzierte Version ihrer Seite.
Genau diese Vereinfachung und Optimierung für die mobile Nutzung von Webinhalten und Online-Werkzeugen sind das Erfolgsmerkmal von Apps. Mit diesen Kleinstprogrammen muss niemand mehr umständlich über einen Browser auf dem kleinen Handydisplay nach der passenden Website suchen. Einmal auf dem Smartphone über einen App-Store installiert, reicht ein Klick und das für die mobile Nutzung optimierte Webprogramm hilft ohne Umwege bei der Erfüllung so ziemlich aller denkbaren mobilen Wünsche. Statt einer Google-Trefferliste mit Links für die Wettervorhersage gibt es die Wetterprognose direkt aufs Display.
Das Internet ist das gleiche - nur die Nutzungsart unterscheidet sich
Wäre zum Schluss nur noch ein Missverständnis der mobilen Kommunikation zu klären. Denn die oftmals genutzte Formulierung „Mobiles Internet” führt in die Irre, klingt es doch nach einem speziellen Internet fürs Handy. Dabei ist es genau das gleiche eine Internet - das eben nur mobil genutzt wird. Und zwar immer öfter von immer mehr Kunden in Deutschland und in aller Welt.
Quelle: E-Plus-Gruppe
Internet der Dinge oder: Das ewige Gleichnis vom schlauen Kühlschrank
06.09.2012
mit freundlicher Zustimmung von E-Plus Gruppe lesen Sie hier einen Beitrag von Ulrich Coenen Innovation
Internet der Dinge: Intelligenter Kühlschrank
Haben Sie das auch schon gehört? In der vernetzten Welt wird demnächst sogar der Kühlschrank die Milch nachbestellen, sobald diese leer ist! Merkwürdigerweise ist dieser Kühlschrank das Sinnbild für die Vernetzung von intelligenten Geräten und Maschinen geworden. Um das Phänomen „Internet der Dinge” zu erklären, greift man gerne auf den Kühlschrank zurück. Ein einfaches Beispiel, das jeder gut nachvollziehen kann.
Doch während dieser schlaue Kühlschrank immer noch ein Nischendasein fristet, haben die Maschinen und Geräte um uns herum schon längst damit begonnen, untereinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Für dieses Kommunikationsverhalten gibt es viele Begriffe. „Machine-to-Machine” oder „Internet der Dinge” sind dabei die populärsten. Die E-Plus Gruppe hat sogar einen eigenen Geschäftsbereich gegründet, der sich speziell mit dieser sogenannten M2M-Technologie befasst. Dort werden Unternehmen Datenprodukte angeboten, die es Maschinen ermöglicht, miteinander zu kommunizieren.

Internet der Dinge oder:
Das ewige Gleichnis vom schlauen Kühlschrank
Foto: E-Plus
Was verbirgt sich dahinter? Prinzipiell handelt es sich um eine Technologie, die Geräte internetfähig macht. Maschinen werden mit einem Modem ausgestattet, welches Daten senden und empfangen kann. Gleichzeit haben die Geräte Sensoren, um die wesentlichen Informationen zu erfassen, die sie schließlich melden sollen. Ein fiktiver Dialog der Maschinen könnte dann folgendermaßen klingen:
- „Ich habe keine Zigaretten mehr”, sagt der Zigarettenautomat.
- „Ich habe kein Wechselgeld mehr”, sagt der Colaautomat.
- „Meine Glühbirne ist defekt und muss ausgetauscht werden”, sagt die Straßenlaterne.
- „Familie Müller hat letztes Jahr 3.500 KWh verbraucht”, sagt der Stromzähler.
Zugegeben, das klingt sehr nach einem Monolog, aber das Prinzip sollte klargeworden sein. Warum bekommt man aber so wenig von der Vernetzung der Maschinen mit? Der Grund ist ganz einfach: Unternehmen misstrauen neuen Technologien. Das beste Argument, sie zu überzeugen, ist das Versprechen, Kosten zu sparen. Somit setzen Firmen dort auf Machine-to-Machine Kommunikation, wo sie offensichtlich schnell Geld einsparen können. Wenn der intelligente Stromzähler automatisch meldet, wie viel Strom Familie Müller letztes Jahr verbraucht hat, muss man keinen Außendienstmitarbeiter zum Ablesen des Zählerstandes vorbei schicken. Das spart bares Geld.
So hält diese Technologie also erst einmal Einzug in Geschäftsprozesse, mit denen der normale Endverbraucher nicht in Berührung kommt. Wenn Sie im Büro einen Kopierer nutzen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser mit einer SIM-Karte ausgestattet ist und eigenständig an die Herstellerfirma meldet, wann die nächste Wartung fällig ist. Dies bekommen Sie nur nicht mit. Ob nun aber der Füllstand der Druckerpatrone oder der Füllstand der Milchflasche im Kühlschrank gemeldet wird – die Idee ist die gleiche, die Technologie auch. Nur interessiert sich heutzutage noch keiner so richtig für den Füllstand von Milchflaschen. Das ist aber auch nur eine Frage der Zeit. Es kann durchaus sein, dass in 5 Jahren der mobile Supermarktservice bei Ihnen klingelt und Ihnen mitteilt, dass Ihre Wurst abgelaufen und die Milch leer ist.
Haben Unternehmen in diese neue Technologie Vertrauen gefasst, werden sie sicherlich auch überlegen, ob es Anwendungsmöglichkeiten gibt, die über das reine Einsparen von Kosten hinausgehen. Dabei könnten tatsächlich spannende Produkte entstehen, die auch für Endverbraucher sichtbar werden. Besonders weit gekommen ist man hier allerdings noch nicht. Ein gelungenes Beispiel ist der Amazon Kindle. Fragen Sie mal einen Nutzer, ob er weiß, wie die Bücher geladen werden. Wahrscheinlich weiß noch nicht mal jeder 2., dass der Kindle mit einer SIM-Karte ausgestattet ist. Diese ist nämlich fest verbaut, und als Käufer schließt man keinen Mobilfunkvertrag mehr ab.
Derzeit gibt es noch nicht besonders viele solcher Beispiele vom Internet der Dinge im Umfeld von Privatanwendern. Man muss den Unternehmen allerdings auch zugutehalten, dass dies ein schwieriges Terrain ist. Jede gute Idee konkurriert fast automatisch mit einem Smart Phone und einer schlauen App. Wozu soll ich mir ein intelligentes Navi mit SIM-Karte kaufen, wenn mein iPhone dies genauso gut kann? Warum soll ich mit einem GPS-Tracker meine Joggingstrecke auswerten, wenn ich mir die gleiche Anwendung für 0,79 Euro aus dem AppStore herunterladen kann?
Trotzdem können wir gespannt sein, mit welchen kreativen Ideen die Unternehmen das Internet der Dinge zu uns tragen werden. Im Bereich Home Automation sind schon erste spannende Produkte sichtbar. Schon lange wird an Ansätzen geforscht, das Haus intelligenter zu machen. Dabei kommt es zu einem cleveren Zusammenspiel von einzelnen Elementen wie Lichtschalter, Stromschalter, Rauchmelder, Alarmanlage, usw. Diese Liste lässt sich wahrscheinlich noch lange fortsetzen. Und dann ist es auch nicht mehr besonders weit, bis wir uns vom intelligenten Stromzähler über die schlaue Steckdose bis zum Kühlschrank vorgetastet haben. Wer weiß, vielleicht bestellt sogar der Kühlschrank irgendwann automatisch Milch nach, sobald sie leergetrunken ist.
Uli Coenen ist Chief Innovation Officer (CIO) der E-Plus Gruppe. Er schreibt monatlich auf UdL Digital über Innovationen aus dem Mobilfunk.
Wenn die Kuh per SMS den Bauern ruft
19.10.2012
- M2M-Lösung für die Landwirtschaft - Überwachung von Kühen in Echtzeit
- Deutsche Telekom und MEDRIA schließen Partnerschaft im Bereich M2M.
- Lösung im M2M Marketplace der Telekom erhältlich
Auch Kühe können SMS verschicken - dank Machine-to-Machine-Kommunikation (M2M). Mit den Produkten Vel'Phone® und HeatPhone® von MEDRIA Technologies, französischer Spezialist für Lösungen zur Echtzeit-Überwachung, erhält der Landwirt automatisch Nachricht, wenn die Kuh bald ein Kalb bekommen wird oder empfangsbereit ist. Die Deutsche Telekom und MEDRIA haben jetzt eine Partnerschaft für den Vertrieb dieser Lösung für die Landwirtschaft geschlossen und statten in einem ersten Schritt europaweit 5.000 Bauernhöfe mit diesen Anwendungen und SIM-Karten der Telekom aus.
„M2M-Lösungen können in nahezu allen Branchen einen hohen Nutzen bringen”", sagt Jürgen Hase, Leiter des M2M-Kompetenzzentrums der Deutschen Telekom. „Wir setzen auf innovative Partner wie MEDRIA, die die besonderen Anforderungen und Lösungen ihrer Branche kennen. Um die Interessen unserer Kunden bestmöglich zu bedienen, entwickeln und vertreiben wir gemeinsam mit Partnern vielfältige nützliche M2M-Anwendungen.”
Für MEDRIA war die exzellente Netzqualität der Deutschen Telekom Ausschlag gebend. „Die hohe Qualität des Telekom Mobilfunknetzes garantiert uns, dass die wichtigen Infos sicher übertragen werden und hoch verfügbar sind”, sagt Emmanuel Mounier, MEDRIAs Managing Director. „Ein weiterer Vorteil ist die Unterstützung der Deutschen Telekom beim Marketing - inklusive der Nutzung des M2M Marketplace, wo jetzt auch unsere MEDRIA Produkte erhältlich sind.”
Spezielle Sensoren in einem Halsband messen die Vitaldaten der Kuh, erfassen ihre Aktivität und senden diese Informationen an einen Datensammler, der im Stall oder auf der Weide installiert wird. Der Datensammler sendet bei Auffälligkeiten mittels M2M-SIM-Karte über das hoch verfügbare Telekom Mobilfunknetz eine entsprechende Information als SMS an den Bauern. Zusätzlich werden die gesammelten Daten alle 30 Minuten per Mobilfunk an einen Server übertragen und archiviert. Die gemessenen Daten sind nicht nur als SMS auf dem Handy verfügbar. Der Bauer kann die Vitaldaten seiner Kühe auch auf der Internet-Plattform „Daily Web Services” nachvollziehen.
Dank der M2M-Kommunikationstechnologie muss der Landwirt nicht mehr nächtelang im Stall ausharren. Die M2M-Lösung gibt ihm die Sicherheit, dass er rechtzeitig vor der Geburt eines Kälbchens bei der Kuh sein und eingreifen kann oder die kurze Brunstzeit der empfangsbereiten Kuh früh genug erkannt wird. Das Resultat: eine höhere Reproduktionsrate der Herde und, durch die Vermeidung von Notfällen, gleichzeitig weniger Stress für den Landwirt.
Weitere Informationen zum Thema M2M finden Sie auf der Website der Deutschen Telekom unter https://www.telekom.com/de/medien/mediencenter/medienmappen/medienmappen-2016/m2m-kommunikation.
Zum Thema „Bauernhof 2.0: Wachsame Weidenzäune und mitdenkende Maschinen” siehe auch Telekommunikation Oktober bis Dezember 2014/2015
Quelle: Deutsche Telekom AG
Das WWW wird 20 Jahre alt
30.04.2013
- In Deutschland nutzen 55 Millionen das Web.
- Weltweit ist heute jeder 3. Mensch online.
 Das World Wide Web (WWW) am 30. April 2013 20 Jahre alt. Am 30. April 1993 wurde die Technologie für Internet-Inhalte zur allgemeinen Nutzung freigegeben. Vorher war sie bereits einige Jahre im Test- und Entwicklungsbetrieb. In diesem Jahr werden mehr als 2,7 Milliarden Menschen das Internet nutzen, die allermeisten von ihnen greifen dabei auf das World Wide Web zurück. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Zahl damit fast vervierfacht. „Das Internet hat die Art, wie wir leben und arbeiten, tiefgreifend verändert”, sagt BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf.
Das World Wide Web (WWW) am 30. April 2013 20 Jahre alt. Am 30. April 1993 wurde die Technologie für Internet-Inhalte zur allgemeinen Nutzung freigegeben. Vorher war sie bereits einige Jahre im Test- und Entwicklungsbetrieb. In diesem Jahr werden mehr als 2,7 Milliarden Menschen das Internet nutzen, die allermeisten von ihnen greifen dabei auf das World Wide Web zurück. In den vergangenen 10 Jahren hat sich die Zahl damit fast vervierfacht. „Das Internet hat die Art, wie wir leben und arbeiten, tiefgreifend verändert”, sagt BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf.
In Deutschland sind heute rund 78 Prozent der über 14-Jährigen online, das sind fast 55 Millionen Bundesbürger. 9 von 10 deutschen Internetnutzern kaufen online ein. 8 von 10 teilen Inhalte im Netz mit anderen, wie zum Beispiel Fotos oder auch Erfahrungen mit Produkten und Dienstleistungen.
Vater des WWW ist Tim Berners-Lee. Er startete das Projekt 1989 beim Europäischen Kernforschungszentrum CERN als Projekt. Die Idee entstand ursprünglich, um die Informationsflut in komplexen wissenschaftlichen Projekten besser beherrschbar zu machen. Bis zu einem weltweiten Standard war es damals noch ein weiter Weg: 1990 entstanden der erste Browser - ein Programm zum Surfen im Netz - sowie die erste Webseite (info.cern.ch). 3 Jahre später veröffentlichte der damalige Informatik-Student Marc Andreessen den Browser Mosaic, der als Vorläufer des Programms Netscape das Web populär machte. 1994, ein Jahr nach der Freigabe der Web-Technologie, wurde das „World Wide Web Consortium” (W3C) gegründet - ein internationales Gremium, das seitdem an der Weiterentwicklung der Web-Standards und technischen Protokolle arbeitet.
Quelle: BITKOM
Das Handy wird 30
06.06.2013
- Am 13. Juni 1983 kam das erste Handy auf den Markt.
- Prognose: 2014 werden weltweit rund 7 Milliarden Handys genutzt.

Motorola Dynatac 8000X
Quelle: aus Wikipedia,
CC BY-SA 3.0
Urheber Redrum0486
vergrößern
 Das Handy feiert 30. Geburtstag. Am 13. Juni 1983 brachte Motorola mit dem „Dynatac 8000X” das erste Mobiltelefon auf den Markt. Mit den heutigen Smartphones ist das Gerät nur schwer zu vergleichen. Es war rund 800 Gramm schwer und 33 Zentimeter lang. Zum Vergleich: Moderne Smartphones wiegen zwischen 110 und 180 Gramm und sind nicht größer als 14 Zentimeter. Auch bei der Akku-Laufzeit unterscheidet sich der Handy-Urahn deutlich von modernen Mobiltelefonen. Lediglich 30 Minuten Gesprächszeit waren mit dem Dynatac möglich. „Die Erfolgsgeschichte des Handys zeigt eindrucksvoll, wie schnell IT-Innovationen die Welt verändern”, sagt BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf. Für 2014 sagt die Internationale Fernmeldeunion voraus, dass weltweit die Schwelle von 7 Milliarden aktiv genutzten Handys durchbrochen wird. Damit gibt es bald annähernd so viele aktiv genutzte Handys wie Menschen.
Das Handy feiert 30. Geburtstag. Am 13. Juni 1983 brachte Motorola mit dem „Dynatac 8000X” das erste Mobiltelefon auf den Markt. Mit den heutigen Smartphones ist das Gerät nur schwer zu vergleichen. Es war rund 800 Gramm schwer und 33 Zentimeter lang. Zum Vergleich: Moderne Smartphones wiegen zwischen 110 und 180 Gramm und sind nicht größer als 14 Zentimeter. Auch bei der Akku-Laufzeit unterscheidet sich der Handy-Urahn deutlich von modernen Mobiltelefonen. Lediglich 30 Minuten Gesprächszeit waren mit dem Dynatac möglich. „Die Erfolgsgeschichte des Handys zeigt eindrucksvoll, wie schnell IT-Innovationen die Welt verändern”, sagt BITKOM-Präsident Prof. Dieter Kempf. Für 2014 sagt die Internationale Fernmeldeunion voraus, dass weltweit die Schwelle von 7 Milliarden aktiv genutzten Handys durchbrochen wird. Damit gibt es bald annähernd so viele aktiv genutzte Handys wie Menschen.

Das Foto dokumentiert die Entwicklung des mobilen Telefons von 1983 bis 2006:
von links nach rechts:
Motorola 8900X-2, Nokia 2146 orange 5.1, Nokia 3210,
Nokia 3510, Nokia 6210, Ericsson T39, HTC Typhoon
Anders (CC BY-SA 3.0)(Wikipedia)
Die Erfolgsgeschichte des klassischen Handys wiederholt sich derzeit beim Smartphone. 2007 kamen die ersten App-fähigen Geräte mit großem Touchscreen auf den Markt. Seitdem sind die Verkaufszahlen explodiert. Während 2008 noch 3,1 Millionen Geräte in Deutschland verkauft wurden, sind es in diesem Jahr nach Berechnungen des Marktforschungsinstituts EITO bereits 28 Millionen. 96 Prozent des Mobilfunkmarktes entfallen mittlerweile auf Smartphones, die restlichen 4 Prozent auf einfache Handys. Kempf: „Smartphones setzen die Erfolgsgeschichte des Handys fort.”
| Entwicklung der Anzahl der Mobilfunkanschlüsse in Deutschland seit 1992 | |
| Jahr | Mobilfunkanschlüsse (in Mio.) |
| 1992 | 0,53 |
| 1993 | 1,77 |
| 1994 | 2,48 |
| 1995 | 3,76 |
| 1996 | 5,55 |
| 1997 | 8,28 |
| 1998 | 13,91 |
| 1999 | 23,47 |
| 2000 | 48,15 |
| 2001 | 56,13 |
| 2002 | 59,13 |
| 2003 | 64,84 |
| 2004 | 71,32 |
| 2005 | 79,27 |
| 2006 | 85,65 |
| 2007 | 97,15 |
| 2008 | 107,25 |
| 2009 | 108,26 |
| 2010 | 108,85 |
| 2011 | 114,13 |
| Entwicklung Mobilfunkmarkt in Deutschland seit 2000 | ||
| Jahr | Mobiltelefone (Umsatz in Mrd.) | Umsatz mit Mobil-telefondiensten (Mrd. Euro) |
| 2000 | 3,7 | 11,0 |
| 2001 | 2,4 | 14,4 |
| 2002 | 2,1 | 16,5 |
| 2003 | 2,5 | 17,6 |
| 2004 | 2,8 | 18,9 |
| 2005 | 2,9 | 20,2 |
| 2006 | 2,9 | 21,0 |
| 2007 | 3,0 | 20,4 |
| 2008 | 3,1 | 20,3 |
| 2009 | 4,2 | 20,2 |
| 2010 | 5,5 | 20,8 |
| 2011 | 6,4 | 20,9 |
| 2012 | 7,6 | 21,3 |
| 2013 | 9,2 | 20,8 |
| Methodik: Den Marktprognosen liegen neueste Untersuchungen des European Information Technology Observatory (EITO) zugrunde. EITO liefert aktuelle Daten zu den weltweiten Märkten der Informationstechnologie, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik. EITO ist ein Projekt der Bitkom Research GmbH in Zusammenarbeit mit den Marktforschungsinstituten IDC und GfK. Die Angaben zur Entwicklung der Mobilfunkanschlüsse in Deutschland stammen von der Bundesnetzagentur. |
||
Quelle: BITKOM
Erste Hilfe Notrufsäule Smartphone
16.09.2013
Bis vor wenigen Jahren standen sie fast an jeder Bundes- oder Landesstraße, heute gibt es sie nur noch an Autobahnen: Notrufsäulen. Die orangefarbenen Säulen verschwanden unauffällig und geräuschlos aus dem Straßenbild. Echte Notrufsäulen werden in der heutigen Zeit kaum mehr benötigt. Smartphone und Handy haben sie abgelöst.
Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Verkehrsunfälle 2013 rückläufig. Das ist gut so, denn jeder Unfall ist einer zu viel. Dennoch hat so gut wie jeder bereits Erfahrungen auf seine Art gemacht: mit Unfällen oder liegengebliebenen Verkehrsteilnehmern auf täglich genutzten Strecken. Während hier meist Hilfe schnell zur Stelle ist, wird ein Unfall oder ein Motorschaden auf abseits gelegenen Straßen schnell zu einem größeren Problem. Insbesondere im Herbst oder Winter, bei Sturm, Regen oder gar tiefem Frost fernab jeglicher Zivilisation. Vor dem Antritt längerer Fahrten oder abseits vielbefahrener Routen sollte daher vorgesorgt werden.

Ein Mobiltelefon ist heutzutage unentbehrlich –
nicht nur bei Notfällen auf dem Land.
Foto: E-Plus Gruppe
Rufnummern abspeichern
Wichtig ist die europaweit einheitliche Notrufnummer 112 im Telefonspeicher des Mobiltelefons. In einem echten Notfall vergisst man leicht die einfachsten Dinge. So auch nicht selten die ansonsten sehr bekannte Notrufnummer. Doch Achtung: Seit 2009 lässt sich der Notruf nur noch mit einer eingelegten und aktivierten Mobilfunkkarte anwählen. Ein „leeres” Handy oder Smartphone ist hingegen als Notrufzentrale nicht mehr zu gebrauchen. Moderne Smartphones können aber noch wesentlich mehr: Sie unterstützen heute auf komfortable Weise die Unfallaufnahme. So verfügen Smartphones über eine eingebaute, qualitativ hochwertige Fotokamera. Sie ist hervorragend geeignet, um Schäden für die Versicherung festzuhalten. Wer auf Nummer sicher gehen will, schickt die Fotos gleich an seine persönliche E-Mail-Adresse oder direkt vom Unfallort mit einer kleinen Schadensmeldung an den Versicherer. Wer nicht weiß, wo er sich befindet, beispielsweise nach einem nächtlichen Wildunfall auf dem Land, dem hilft ebenfalls das Smartphone: Dank eines eingebauten GPS-Empfängers lässt sich der eigene Standort schnell orten und so Helfern mitteilen.
Akku rechtzeitig vorher laden
Was hilft ein Mobiltelefon, wenn es im entscheidenden Augenblick nicht geladen ist? Damit das nicht passiert, sollte das Mobiltelefon vor Fahrtantritt aufgeladen werden. Der Fachhandel hält Ladebuchsen für die Kfz-Steckdose als Zubehör bereit. In Verbindung mit einem USB-Ladekabel lässt sich das Mobiltelefon so während der Fahrt weiter mit Strom versorgen.
Quelle: E-Plus Gruppe
40 Jahre Notruf 112: So wird das Handy zum Lebensretter
19.09.2013
- Vorrang im Mobilfunknetz für Notrufe
- 1,2 Millionen Notrufe im Jahr alleine im Netz von Vodafone
- Apps unterstützen Retter bei stabiler Seitenlage und Herzmassage
 „Ich darf Ihnen sagen: Ihr Dickschädel hat sich durchgesetzt. Wir haben den Notruf beschlossen”, hieß es nach einer Sitzung der Ministerpräsidenten am 20.September 1973, nur 3 Tage später war die 112 erreichbar. Heute, nach 40 Jahren, gehen allein im Vodafone-Netz jährlich 1,2 Millionen echte Notrufe ein. Im Notfall hilft jedes Handy, das eine SIM-Karte enthält. Die Notruftaste oder das Eintippen der 112 verbindet immer direkt mit der nächsten Rettungsleitstelle. Diese kann den Unglücksort schnell ermitteln: Beim Notruf wird die Funkzelle mitgemeldet. Auch beim Notruf aus dem Festnetz lässt sich der Standort ermitteln.
„Ich darf Ihnen sagen: Ihr Dickschädel hat sich durchgesetzt. Wir haben den Notruf beschlossen”, hieß es nach einer Sitzung der Ministerpräsidenten am 20.September 1973, nur 3 Tage später war die 112 erreichbar. Heute, nach 40 Jahren, gehen allein im Vodafone-Netz jährlich 1,2 Millionen echte Notrufe ein. Im Notfall hilft jedes Handy, das eine SIM-Karte enthält. Die Notruftaste oder das Eintippen der 112 verbindet immer direkt mit der nächsten Rettungsleitstelle. Diese kann den Unglücksort schnell ermitteln: Beim Notruf wird die Funkzelle mitgemeldet. Auch beim Notruf aus dem Festnetz lässt sich der Standort ermitteln.
„Der Notruf hat immer höchste Priorität. Ist unser Netz etwa bei Massenveranstaltungen tatsächlich einmal ausgelastet und jemand ruft die 110 oder die 112 an, so wird sofort ein Platz in der Leitung freigeräumt. Diese Vorrangschaltung ist notwendig, um keine Zeit zu verlieren”, sagt Rolf Reinema, Leiter der Unternehmenssicherheit bei Vodafone. Ein Notruf lässt sich bei jedem Handy mit aktiver SIM-Karte absetzen, auch ohne Gesprächsguthaben oder aktiver PIN-Sperre. Befindet sich der Nutzer außerhalb des Versorgungsgebiets seines Anbieters, erfolgt der Notruf automatisch über ein anderes Mobilfunknetz.
Für Smartphone-Nutzer kann im Notfall nicht nur ein Anruf an die 112 lebensrettend sein, sondern auch eine App: In der Applikation „Echo 112” wird beispielsweise ein SOS-Button gedrückt. Die App erkennt die Unglücksstelle, wählt die richtige Rettungszentrale aus, ruft sie an und übermittelt den genauen Einsatzort für die Hilfskräfte. Wer selbst einmal einem Verletzten helfen muss, den erinnern Anwendungen wie „Erste-Hilfe-App” und „eErsteHilfe - Rotes Kreuz” daran, wie man Verbände korrekt anlegt oder, wie die stabile Seitenlage und Herzmassage funktionieren. In anderen Apps wie „ICE - im Notfall” können Nutzer wichtige Informationen zu Krankheiten, Blutgruppe und Organspende sowie die Telefonnummer eines Bekannten eintragen, der über den gesundheitlichen Zustand Bescheid weiß. Das kann den Rettern und Medizinern im Notfall helfen.
Bei einem schweren Unfall ist die schnelle Information an die Rettungsdienste überlebenswichtig. Europaweit ist daher ein elektronisches Emergency-Call-System in Vorbereitung. Bei einem schweren Aufprall eines Fahrzeuges sendet eine SIM-Karte demnächst automatisch einen Notruf einschließlich Standortdaten. Neben dem Emergency-Call wird die Vernetzung der Autos untereinander künftig zusätzlich für Sicherheit sorgen, z.B. durch Kollisionswarnungen. Dank integrierten SIM-Datenkarten von Vodafone können Autos die nachfolgenden Fahrzeuge warnen, zum Beispiel vor Glatteis, einem Unfall, oder Stau an einer unübersichtlichen Stelle. Wichtigste Erkenntnisse eines Forschungsprojektes von Vodafone, Ericsson, Ford, BMW und dem Bundesamt für Straßenwesen: Vernetzte Autos machen den Straßenverkehr sicherer und flüssiger. Schon bald wird jeder Fahrer dank LTE-Mobilfunk einen persönlichen Warnmelder an Bord haben und Gefahren erkennen, bevor es zu spät ist.
Quelle: Vodafone
Surfin' 5G Gangnam Style - Blick in die Zukunft: 5G
von Claudia Nemat, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG, Europa und Technik
21.02.2014
Ein Song reichte aus um im Jahr 2012 den Tourismus in Südkorea deutlich anzukurbeln und für eine positive Außenhandelsbilanz des Landes zu sorgen. Zumindest sagt man das über den unglaublichen Erfolg von PSYs Song „Gangnam Style”, welcher den weltbekannten angesagten Stadtteil von Seoul parodiert. Dennoch, diese boomende Region Asiens ist für ihr Wachstum nicht nur auf Songwriter angewiesen. Ende Januar 2014 kündigte Südkorea einen Plan für die Einführung eines Mobilfunknetzes der 5. Generation (5G) im Wert von 1,6 Billionen Won (1,5 Milliarden Dollar) an. Damit könnten Filme in voller Länge in nur einer Sekunde heruntergeladen werden. Die Planungen sehen für 2017 eine Testphase vor und die vollständige kommerzielle Verfügbarkeit des 5G-Dienstes ist für Dezember 2020 geplant.

Claudia Nemat, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG, Europa und Technik
Foto: Deutsche Telekom AG
Ja, wir sprechen über 5G. Dies ist der nächste Standard für das mobile Internet - und 2014 eines der Trendthemen des Mobile World Congress in Barcelona. Wenn LTE und LTE Advanced schnell sind, stellt 5G eine neue Geschwindigkeitsdimension dar. Es wird den Nutzern von Smartphones mehr als nur ein Glasfasernetz-Feeling geben. Noch bestehen allerdings zahlreiche offene Fragen, denn die Standards sind noch nicht klar definiert.
4G ist bisher nur für einen Teil der Privatkunden verfügbar. Trotzdem hat der „Goldrausch” der nächsten Generation bereits Einzug gehalten. Es geht darum, die Standards für die 5G-Geschwindigkeiten festzulegen. Staaten und Firmen beschäftigen sich bereits im Detail damit.
Viele Unternehmen behaupten, dass die 5G-Technologie schon 2020 verfügbar sein wird. In Anbetracht der schnellen Entwicklung der Technik scheint diese Prognose einleuchtend. Bis jetzt gab es ungefähr alle 10 Jahre eine neue Mobilfunknetz-Generation. Ein schneller Blick in Statistiken zeigt: 1981 wurde das erste 1G-System eingeführt, 11 Jahre später folgte 2G. 2001 begann die Einführung von 3G, während mehr als ein Jahrzehnt später die 4G -Systeme bereits vollständig mit IMT Advanced konform waren. Für Erbsenzähler: ja, de facto erschienen Vorläufer der 4G-Systeme schon früher auf der Bildfläche. Nichtsdestotrotz, es würde einer gewissen Logik folgen, wenn wir 5G im Jahr 2020 plus/minus x sehen würden.
Allerdings gibt es einen wichtigen Aspekt jenseits der Zugangsgeschwindigkeit: Moderne mobile Netzzugangstechnologie bedeutet auch mehr Verkehr in den Backbone-Netzen. Daher muss unsere Branche nicht nur in Zugangstechnologie investieren, sondern auch in neue Architekturen für das Backbone-Netz. Andernfalls kommt der 5G-Ferrari nur im Schneckentempo voran. Derzeit befinden sich die europäischen Telekommunikationsbetreiber in einer Zwangslage zwischen Auktionen und Regulierungen, die ihre Geldmittel aufzehren, und zukünftigen technischen Herausforderungen, für deren Bewältigung Investitionen erforderlich sein werden. Gerade jetzt muss Europa einen Zahn zulegen. Besonders in Asien haben Staaten ein großes Interesse daran, den nächsten weltweiten Mobilfunkstandard zu bestimmen. Asien hat den entscheidenden Einfluss der Mobiltechnik auf die Zukunft verstanden.
Es gibt heute 1,2 Milliarden mobile Breitbandnutzer. Diese Zahl wächst pro Jahr um Hunderte von Millionen. Wir werden einen enormen Zuwachs bei der Nutzung von (HD-)Video-Diensten erleben. Bereits jetzt ist die Nutzung bei LTE-Anwendern wesentlich höher als bei 3G-Anwendern. Die Nutzung von Cloud-basierten Anwendungen wird steigen. Außerdem gibt es eine zusätzliche Quelle für die weitere Steigerung des mobilen Breitbandverkehrs: Dies ist der Paradigmenwechsel von auf den Menschen konzentrierten Systemen hin zu Systemen, bei denen Mensch und Maschine im Mittelpunkt stehen. Einige mag es vielleicht überraschen, aber der Kühlschrank und der Herd mit IP-Adresse sind bereits Realität.
Wie verschiedene Studien zeigen, ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Geräte die mit dem Internet verbunden sind von 5 Milliarden im Jahr 2010 auf 50 Milliarden im Jahr 2020 steigen wird, hauptsächlich durch die Einführung intensiver Machine-to-Machine-Kommunikation. Wir sollten diesen Trend nicht verpassen. Ob wir es wollen oder nicht - das ist der nächste Gangnam Style der Mobilfunktechnik.
Quelle:Deutsche Telekom AG
Was ist IP-basierte Telefonie?
IP-Telefonie: Ingo Hofacker: „Das Netz der Zukunft spricht IP”29.09.2014
- Interview mit Dr. Ingo Hofacker, Leiter Segmentmarketing Privatkunden Telekom Deutschland und Gesamtverantwortlicher für die IP-Umstellung in Deutschland.

Dr. Ingo Hofacker / Foto Deutsche Telekom AG
Die Telekom will bis 2018 ihr gesamtes Netz auf IP umstellen. Warum wollen Sie das machen und was ist das überhaupt?
Die Abkürzung IP steht für Internet Protokoll. Das ist ein Standard für den Datenverkehr in Netzwerken wie dem Internet. IP stellt sicher, dass weltweit Datenpakete mit völlig unterschiedlichen Inhalten wie Sprache, Text, Musik oder Videos über das Internet verteilt werden und so völlig unterschiedliche Geräte wie Fernseher, Telefon, Handy oder PC Daten austauschen können. Technik wächst zusammen. Das Internet Protokoll ist der Universalcode des 21. Jahrhunderts. Deshalb wird unser Netz in Zukunft nur noch eine Sprache sprechen: IP.
Das heißt, das gute alte Festnetztelefon ist bei Ihnen bald Geschichte und ich kann zukünftig nur noch über meinen Computer telefonieren?
Ihr Telefon können Sie in der Regel auch weiterhin nutzen. Wir modernisieren das Netz, in dem Sie telefonieren. Bisher haben wir ein leitungsbasiertes Netz, in dem jeder Telefonanschluss über 2 Kupferadern an die Vermittlungsstelle angeschlossen ist. In Zukunft werden Telefongespräche als „IP-Pakete” transportiert und dabei immer den schnellsten Weg nehmen. So, wie es etwa im Internet und übrigens auch im Mobilfunk schon lange Standard ist.
Wenn sich für Ihre Kunden nichts ändert, warum kündigen Sie dann die Verträge?
Wir werden alte Technik abschalten, die nicht mehr benötigt wird. Aus rechtlichen Gründen müssen wir dabei auch Altverträge kündigen. Und natürlich werden wir den Kunden mehr Service und Dienste bieten können. Nur ein Beispiel: Im alten Telefonnetz ist ein Großteil der Leitungen und Frequenzen nur für das Telefonieren reserviert, selbst dann, wenn gerade niemand sie nutzt. Im IP-Netz wird das Kabel in seiner gesamten Frequenzbreite zum Alleskönner: Je nach aktuellem Bedarf laufen darüber Internet-Daten, Telefongespräche, das Fernsehprogramm oder in Zukunft ganz viele andere Dienste, von denen wir heute noch gar keine Vorstellung haben. Gerade im ländlichen Raum profitieren somit sehr viele Kunden von IP. Mit dem Umstieg erhöht sich ihre Internet-Bandbreite. Möglich macht dies der Anschlussstandard Annex-J, der Frequenzen besser ausnutzt.
Die Verbraucherzentrale Sachsen wirft Ihnen vor, dass Sie in Ihren Kündigungsschreiben nicht die Hintergründe der Umstellung erläutern. Haben Sie etwas zu verbergen?
Wir haben unser Vorgehen mit der Bundesnetzagentur und auch mit der Verbraucherzentrale NRW besprochen und auch schon bei anderen Umstellungen so praktiziert. Wenn Kunden Nachfragen haben, dann können sie sich natürlich an uns wenden. Das Schreiben ist aus unserer Sicht der Auftakt für eine Kommunikation in einen Wechsel. Es macht aber keinen Sinn, ein solches Schreiben mit Informationen zu überfrachten. Zudem verweisen wir in den Schreiben auf zusätzliche Informationsquellen auf unseren Internetseiten.
Wäre es nicht einfacher, das alte Festnetz weiter zu betreiben?
Diese Technik ist über 100 Jahre alt. Sie hat in Deutschland lange funktioniert, aber jede Technologie kommt irgendwann an das Ende ihrer Lebenszeit. Es wird in naher Zukunft schwierig werden, zuverlässig Ersatzteile zu bekommen. Darauf reagieren wir frühzeitig. Heute existieren in Deutschland mehrere getrennte Netze nebeneinander, die historisch so gewachsen sind. Mehrere Netze zu betreiben, kostet Zeit und Geld. Ressourcen, die besser anderswo eingesetzt werden können, etwa im Breitbandausbau.
Im ersten Schritt stellen Sie Kunden in 53 Großstädten wie Hamburg, Berlin und München um. Dort gibt es das schnelle Internet bereits. Warum sollten diese Kunden auf IP wechseln?
Diese Städte sind bereits 2016 für die Umstellung vorgesehen. Deshalb schreiben wir dort Kunden an, wenn sie von uns Telefon und Internet bzw. Telefon, Internet und Fernsehen beziehen, ihr Vertrag ausläuft und einen PSTN/ISDN-Anschluss haben. In dem neuen IP-basierten Netz sind PSTN/ISDN überflüssig. Deshalb stellen die Zulieferer den Support für diese Netzkomponenten auch demnächst ein. Trotzdem muss sich niemand Sorgen machen. Das neue Netz steht bereit. PSTN/ISDN werden wir in ein paar Jahren genauso wenig vermissen wie ein Wahlmodem oder Kurbeltelefon. Die Umberatung hat übrigens bereits tausendfach, reibungslos funktioniert. Die meisten Kunden wollen einen schnellen Anschluss, auf welcher Technik der läuft, ist ihnen egal. Und das ist auch richtig so. Technische Details sollte ich als Kunde getrost meinem Netzbetreiber überlassen. Das ist seine Kernkompetenz. Dafür bezahle ich meinen Netzbetreiber.
Wie stellen Sie sich dann das Netz der Zukunft vor?
Das wichtigste Stichwort für mich ist: Konvergenz. Lange haben wir nur darüber gesprochen, dass Dienste im Netz zusammenwachsen. Nun wird die Vision real. Schon heute können Sie im Urlaub per Handy-App den Videorekorder zu Hause programmieren. Bald werden Sie von unterwegs auch den Ladezustand Ihres Elektroautos kontrollieren, Ihre Heizung regeln oder über Ihre Smart Watch die Haustür für den Paketboten öffnen. Im IP-Netz kann dies alles funktionieren. Das IP-Netz ist wie ein großes Orchester, in dem ganz unterschiedliche Instrumente eine Symphonie erzeugen, weil sie perfekt zusammenspielen.
Das sind schöne Zukunftsaussichten. Aber was haben ältere Kunden von IP, die all diese Dienste gar nicht nutzen möchten, sondern weiterhin nur ihr Telefon?
Auch für sie bietet IP viele Vorteile, zum Beispiel HD Voice: Kristallklarer Ton beim Telefonieren mit HD-Telefonen - ganz so, als wäre der Gesprächspartner im selben Raum. Das ist gerade für viele ältere Menschen eine große Erleichterung.

Vor der Erleichterung steht die neue Verkabelung zu Hause. Das ist doch sicher ein großer Aufwand für den Kunden?
Wer nur ein Telefon hat, muss gar nichts umstecken. Diese Kunden werden wir in der Vermittlungsstelle umschalten. Die sprichwörtliche „ältere Dame von nebenan” muss sich also überhaupt keine Gedanken machen. Nur wenn ein Kunde heute einen Breitbandanschluss nutzt, also DSL, VDSL oder Entertain, benötigt er möglicherweise einen neuen Router und eben einen IP-Anschluss. Das Gute ist, dass der Kunden den sogenannten Splitter - eine kleine Box - mit IP nicht mehr benötigt. Diese Box kann einfach abmontiert werden. Die Installation des Routers ist zudem sehr einfach. Es gibt eine grafische Anleitung, Erklärvideos im Netz und natürlich auch einen Vor-Ort-Service. Die meisten der 3,5 Millionen Kunden, die bereits im neuen IP-Netz telefonieren, haben den Umstieg ohne Hilfe geschafft.
Ein Ärgernis bei der IP-Telefonie sind Störungen. Zuletzt gab es Berichte über Ausfälle bei IP.
Es stimmt, dass wir Ende August Störungen bei der IP-Telefonie hatten. Rund 10 Prozent unserer IP-Kunden waren davon betroffen. Das war sehr ärgerlich und wir bedauern die Unannehmlichkeiten. Die Störungen kamen zu einem ungünstigen Zeitpunkt, aber sie ändern nichts daran, dass der Weg zu IP richtig ist. Es ist die modernere, zukunftssichere Technik. IP-Telefonie ist heute bereits genauso stabil wie das bisherige Festnetz und sie wird in Zukunft höher sein, weil wir Komplexität aus dem Netz herausnehmen. Das macht es einfacher, Fehler zu finden und zu beseitigen.
Viele Kunden befürchten, dass ihr Telefon oder ihr Hausnotruf nicht mehr funktioniert, wenn es einen Stromausfall gibt. Kein Strom, kein Router, kein Telefon?
Das deutsche Stromnetz ist eines der besten auf der Welt. Im Durchschnitt sind deutsche Haushalte circa 15 Minuten im Jahr ohne Strom, in 99,997 Prozent der Zeit funktioniert das Stromnetz also ohne Probleme. Die meisten Menschen haben seit Jahrzehnten keinen Stromausfall erlebt. Wer sich aus privaten oder geschäftlichen Gründen gar keine Ausfallzeiten erlauben darf, der sollte über entsprechende Akku-Lösungen nachdenken und in der Regel machen das die betroffenen Menschen und Unternehmen bereits.
Kommen wir zum Preis. Sie nennen viele Vorteile des neuen Netzes, das bedeutet sicher auch höhere Kosten für Ihre Kunden, oder?
Telefonieren ist in den letzten Jahren immer billiger geworden. Wer jetzt umsteigt und noch einen alten Vertrag hat, kann beim Wechsel in der Regel sogar Geld sparen.
Aber ist die Kündigung nicht auch eine gute Gelegenheit für Sie, teurere Verträge zu vermarkten, zum Beispiel zusätzliche Internet-Anschlüsse für Kunden, die diese vielleicht gar nicht benötigen?
Jeder Kunde soll genau das Produkt bekommen, das seinem Bedarf entspricht. Ich weiß, dass es im Vertrieb auch immer mal zu Ausreißern kommt. Wenn wir Hinweise dafür haben, dass ein Mitarbeiter oder ein Geschäftspartner Kunden bewusst falsch berät, dann werden wir dem mit aller Konsequenz nachgehen. Wir haben hier einen guten Ruf zu verlieren.
Kommt die Umstellung zu früh?
Nein. Das gesamte Netz der Telekom auf IP umzustellen ist eine große Herausforderung. Ohne Frage. Solche Umstellungsprozesse sind in der Telekommunikationsbranche aber nichts Ungewöhnliches, sondern tägliches Geschäft. Die Deutsche Bundespost/Deutsche Telekom hat mit der Einführung von ISDN Ende der 1980er-Jahre des letzten Jahrhunderts eine Führungsrolle in Europa übernommen. Jetzt unterstreichen wir diese Führungsrolle durch den Aufbau eines paneuropäischen Netzes auf IP-Basis und der Verschmelzung von Festnetz- und Mobilfunk durch Hybrid. Wir übernehmen Verantwortung. Wir gestalten den Wandel in die Digitale Gesellschaft: Ohne Wandel kein technologischer Fortschritt. Ohne technologischen Fortschritt kein Wohlstand.
- - -
Der Anschluss an die Zukunft
Im Netz der Zukunft steht dem Kunden - mit dem IP-basierten Telekom Anschluss - modernste Anschlusstechnik zur Verfügung. Im Gegensatz zu anderen Anschlussarten werden beim IP-basierten Anschluss alle Verbindungen (Telefonieren, Surfen, Mailen, Faxen, Fernsehen) über das Internet aufgebaut (IP steht für Internet-Protokoll). Dadurch wird das Netz leistungsfähiger und zukunftssicher. Ein Wechsel ins Netz der Zukunft ist bereits jetzt schon problemlos möglich.
Die Vorteile des IP-basierten Anschlusses:
- Die IP-Technologie macht Ihren Anschluss zukunftssicher, der Kunde kann z. B. in vielen Fällen höhere Bandbreiten nutzen als zuvor.
- Mit dem IP-basierten Anschluss stehen viele Funktionen ohne Aufpreis zur Verfügung, z. B. 2 Sprachkanäle und bis zu 10 Rufnummern.
- Über das Kundencenter kann der Kunde Telefonservices einrichten, z. B. eine Rufumleitung aktivieren - am IP-basierten Anschluss völlig kostenlos.
- Die Installation des neuen Anschlusses ist denkbar einfach. Großer Vorteil: Der Kunde benötigt beim IP-basierten Anschluss keinen Splitter und keinen NTBA.
- Dank HD Voice sind Telefonate - geeignete Endgeräte vorausgesetzt - in exzellenter Sprachqualität möglich. Kein Rauschen, kein Hall.
- Die HomeTalk-App ermöglicht es, im WLAN zu Hause Festnetz-Gespräche auch mit dem Smartphone zu führen.
- Nachrichten auf der Sprachbox erreicht der Kunde unterwegs bequem per E-Mail. Er kann seine auch von unterwegs konfigurieren.
- Mit WLAN TO GO surfet man an 12.000 deutschen Telekom Hotspots und über 8 Millionen Hotspots weltweit kostenlos.
- Mit Smart Home ist der Anschluss um den Komfort einer Haussteuerung erweiterbar: Damit kann der Kunde künftig die gesamte Haustechnik per Smartphone oder PC. Beleuchtung, Entertainment, Klimaanlage und andere elektrische Verbraucher regeln und problemlos kontrollieren.
04.03.2015
Warum das alte Festnetz schon bald Geschichte sein wird
Beim Telefonieren tut sich was. In Deutschland, wie in vielen anderen Ländern, wird die Telefonie auf das Internet Protokoll (IP) umgestellt. Mazedonien ist das erste Land in Europa, in dem die Deutsche Telekom ihr komplettes Festnetz mit IP-Technologie betreibt. Es folgen die Slowakei, Kroatien, Montenegro, Ungarn, Rumänien, Griechenland und Deutschland.
Die Telekom, Deutschlands größter Telekommunikationsanbieter, betreibt hierzulande rund 20 Millionen Festnetzanschlüsse. Bis 2018 sollen alle auf die neue IP-Technologie umgestellt sein. Das ist die größte technische Umstellung seit der Digitalisierung der Netze in den 1990er-Jahren. Schon über 5 Millionen Telekom-Kunden nutzen die neue Technik. Dabei hat sich beim Telefonieren nichts geändert: Den Hörer abheben, die Nummer wählen, ein Gespräch führen. Das völlig Neue vollzieht sich unsichtbar und vom Kunden unbemerkt: im Netz.
Das Telefonnetz - Geschichte einer Revolution
Das Telefonnetz, das Public Switched Telephone Network, kurz PSTN, ist ein weltweites, komplexes System, das dem Austausch von Sprache dient und Telefongespräche, die sogenannte Telefonie, abwickelt.
Die Geschichte unseres Festnetzes ist bewegt. 1881 wurden die ersten Fernsprechnetze eingerichtet, vermittelt via Stöpselverbindung per Hand durch das sprichwörtliche „Fräulein vom Amt”. Es folgten einzelne Ortsnetze, ab 1923 sorgten Fernvermittlungsstellen für großflächige Telefonverbindungen. Bis 1912 wurden Telefonleitungen oberirdisch erstellt, danach auch durch unterirdische Verkehrs- und Unterseekabel. 1975 wurde die Wählscheibe gegen die ersten Tastentelefone ausgetauscht. Anrufbeantworter, Faxgeräte, Rufnummernspeicher und Freisprecheinrichtungen erweiterten die Dienste. In den 1990er-Jahren kamen die ersten Schnurlostelefone auf den Markt. Einen großen Umschwung brachte Ende der 1980er-Jahre die Umstellung der bislang elektromechanischen, analogen Vermittlungstechnik auf das digitale ISDN-Netz.
ISDN war der Einstieg in das digitale Zeitalter der Telekommunikation. Erstmals wurde es möglich, mehrere Gesprächsleitungen an einem Anschluss zu betreiben und Sprache, Daten, Text und Bilder über eine Anschlussleitung digital zu übertragen. Doch der ISDN-Standard hat sich überlebt. Die aus den 1990er-Jahren stammende Technik wird mit zunehmendem Alter störanfälliger und wartungsintensiver. Das neue, einheitliche und flexible IP-Netz bietet dem Kunden deutliche Vorteile.
Die neue IP-Telefonie
Heute stehen wir vor einem Schritt vergleichbarer Dimension: Das alte leitungsgebundene analoge oder digitale ISDN-Festnetz wird es schon bald nicht mehr geben. Sein alleiniger Einsatzzweck, nämlich die Übertragung von Sprache, ist aus technischer Sicht überholt.
Bei der modernen Telefonie über das Internet-Protokoll, kurz IP, erfolgt die klassische Sprachübertragung nicht mehr leitungs- sondern paketgebunden. Die Sprache wird digitalisiert, in kleinen Datenpaketen über das Internet an den Empfänger transportiert und dort wieder als Sprache entpackt. Werden keine Telefongespräche geführt, steht die Bandbreite auch für andere Internet-Übertragungen zur Verfügung - ein entscheidender Vorteil gegenüber der alten Festnetz-Technik, bei der die Bandbreiten belegt bleiben, auch wenn sie gar nicht genutzt werden.
Das Netzwerk selbst sorgt dafür, dass ankommende Pakete auf kürzestem Weg weitergereicht und dass beim Ausfall ein alternativer Weg genommen werden kann. Das bedeutet hohe Sicherheit bei der Vermittlung. Das Netz wird viel effizienter genutzt und ausgelastet, seine Verwaltung wird effektiver.
Telefonieren über das Internet
Telefonieren über das Internet ist grundsätzlich nichts Neues. Im sogenannten Voice-over-IP-Verfahren (VoIP) wird bereits mittels Datenverbindung über das Internet telefoniert, etwa über die Computersoftware Skype. Ein Ersatz für den herkömmlichen Telefonanschluss ist VoIP per PC allerdings nicht, denn sie bietet vergleichsweise geringen Komfort und Verbindungsabbrüche sind an der Tagesordnung. Zudem muss der PC ständig eingeschaltet sein und eine konstante Verbindung zum Internet bestehen.
Das ist beim Telefonieren über das Internet Protokoll ganz anders: Die Gesprächsverbindungen über IP erfolgen in hervorragender Sprachqualität und dem Kunden stehen alle Bequemlichkeiten moderner Telefon-Features zur Verfügung. Zudem kann jeder Anschluss ohne zusätzliche Kosten zwei Sprachkanäle nutzen und erhält mindestens 3 Rufnummern. Festnetz-Anrufe können auch über das Smartphone angenommen werden und die Zeiten, in denen Telefonkabel durch das Haus gezogen werden mussten, um auch im Keller oder auf dem Dachboden erreichbar zu sein, sind endgültig Vergangenheit.
Für den Nutzer eröffnen sich zahlreiche neue Möglichkeiten: So kann über das IP-Netz etwa die gesamte Haustechnik gesteuert werden. Mit der IP-Telefonie erhält der Kunde zudem volle Kontrolle über seinen Anschluss: Viele Einstellungen, wie Rufweiterleitungen, Parallelrufe auf mehreren Anschlüssen oder Rufsperren können selber vorgenommen werden. Die Umstellung zur IP-Telefonie stellt darüber hinaus die Voraussetzung für den Internet-Beschleuniger Vectoring dar, mit dem viele Nutzer Geschwindigkeit im Internet gewinnen.
Für den Kunden ist die neue Technik daran erkennbar, dass das Telefon nicht mehr mit der Telefondose an der Wand, der ISDN-Box oder dem Splitter verbunden wird, sondern direkt mit dem Router.
Für die Deutsche Telekom ist IP-Telefonie ein wichtiger Baustein auf dem Weg hin zu einem leistungsstarken, integrierten IP-Netz der Zukunft, in dem alle bestehenden Telekommunikationsnetze zusammengeführt werden. Durch die intelligente Verknüpfung der Netze miteinander erhalten Kunden immer die beste Verbindung, ob privat und beruflich, zuhause und unterwegs - nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft.
IP-Telefonie: Was Sie schon immer über IP wissen wollten, …04.03.2015
- Das Internet Protokoll, Grundlage für die IP-Technologie, wurde 1974 von Vint Cerf und Bob Kahn erfunden. Seitdem wird es von immer mehr Geräten genutzt. 1994 stellte die deutsche Software-Pionierin Michaela Merz die erste VoIP-Software für das Betriebssystem Linux vor. Damit wurde Telefonieren über das Internet möglich.
- Über 5 Millionen Kunden nutzen heute bereits das IP-basierte Netz der Deutschen Telekom in Deutschland. Bis 2018 soll das Netz komplett umgeschaltet sein.
- IPv6, der neue Adressierungs-Standard im Internet bietet genug Geräteadressen, um bis zu 340 Sextillionen Geräte miteinander zu verbinden. Eine Sextillion hat 36 Nullen. Jedes Sandkorn auf der Welt könnte so theoretisch eine eigene Internet-Adresse erhalten.
- Der Wechsel zur IP-Telefonie ist Voraussetzung für den Internet-Beschleuniger Vectoring: Damit erhalten Kunden Zugang zu VDSL-Anschlüssen mit bis zu 100 Mbit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload. Bis Ende 2016 will die Telekom die Zahl der VDSL-fähigen Haushalte von 12 auf 24 Millionen verdoppeln.
- Das analoge Telefon-Netz, die Vorgängertechnologie der IP-Telefonie, gibt es in Deutschland bereits seit 137 Jahren.
- Dank HD Voice klingt Sprache im IP-Netz kristallklar. Das Frequenzspektrum bei HD Voice reicht von 50 Hz bis 7000 Hz und ist für die Übertragung der menschlichen Stimme optimiert. Im analogen Telefonnetz ist dagegen schon bei 3.400 Hz Schluss. Die Deutsche Telekom hat 2011 als erster Anbieter in Deutschland HD Voice eingeführt. Möglich ist HD Voice im Festnetz mit den Endgeräten Speedphone 100, 500 und 700.
- Mazedonien ist das erste Land in Europa, in dem die Deutsche Telekom ihr komplettes Festnetz auf IP-Technologie umgestellt hat. Es folgen die Slowakei, Kroatien, Montenegro, Ungarn, Rumänien, Griechenland und Deutschland.
- Im IP-Netz ist der Standard ISDN (Integrated Services Digital Network) überflüssig. Bei der Einführung von ISDN gab es - wie bei jedem Technikwechsel - auch viele kritische Stimmen in der Öffentlichkeit. Bei der Telekom stand die Abkürzung ISDN deshalb eine Zeitlang nicht ganz ernst gemeint für: „Ist Sowas Denn Notwendig”.
- Allein im Internet, das auf dem Übertragungsprotokoll IP basiert, wurden 2012 täglich rund 1 Exabyte Daten übertragen, das entspricht der 2500-fachen Datenmenge aller Bücher, die jemals geschrieben wurden.
- Nach einer Studie der Unternehmensberatung Oliver Wyman sollen im Jahr 2016 bereits 80 Prozent der global verkauften Autos über IP vernetzt sein.
- Seit 2010 erhält jeder Neubau und jedes grundsaniertes Gebäude in Deutschland einen intelligenten Stromzähler (Smart Meter), der über IP Verbrauchsdaten liefern kann.
- Seit 2012 ist mehr als die Hälfte aller in Deutschland verkauften Fernsehgeräte Internet-fähig über IP.
- Bereits 2015 werden weltweit mehr als 6 Milliarden Geräte und Systeme über das Internet miteinander verbunden sein - von Computer, über den Fernseher und den tragbaren Pulsmesser bis hin zur intelligenten Haussteuerung oder den Tiefseeforschungsroboter „Wally”.
04.03.2015
Lange Zeit war das Festnetz-Telefon ein echter Einzelgänger. Die analoge Telefontechnik wurde im vorletzten Jahrhundert erfunden, lange bevor es Fernsehen, Internet oder Mobilfunk gab. So war das Festnetz nie dafür ausgelegt, Internet-Daten zu übertragen und mit anderen Netzen und Technologien zusammenzuarbeiten. Wie zu Urgroßmutters Zeiten ist das Festnetz-Telefon zu Hause über 2 starre Kupferadern mit der Vermittlungsstelle verbunden und nutzt ein festes Frequenzband für die Sprachübertragung, das somit für alle anderen Dienste blockiert ist. Ein intelligenter Austausch mit anderen Netzen ist für die alte, analoge Technik zudem kaum möglich.
Das alles ist heute nicht mehr zeitgemäß. In einer Welt, in der die Menschen immer mobiler werden und auch unterwegs auf ihre Daten und Endgeräte zugreifen wollen, muss auch die Technik mobil und flexibel werden.
Deswegen baut die Deutsche Telekom ihr Festnetz um. Aus alten analogen Anschlüssen werden moderne IP-Anschlüsse, die viel mehr können. Im neuen IP-Netz sprechen alle Endgeräte eine gemeinsame Sprache. Sie nutzen das Internet Protokoll (IP), um Daten miteinander auszutauschen. Aus vielen Solisten wird so ein Orchester, das gemeinsam eine Symphonie spielt. Geräte und Dienste wachsen zusammen und bieten so ganz neue Möglichkeiten: Per Handy programmieren Sie beispielsweise den Videorekorder oder sehen, wer gerade an Ihrer Haustür klingelt. Am Fernseher oder PC haben Sie Zugriff auf Ihre digitale Fotosammlung, Ihr elektronisches Telefonbuch oder die Cloud, in der Sie Ihre Daten sichern. Das Handy wird zu einem weiteren Festnetz-Telefon, das alle Anrufe für die Festnetz-Nummer annimmt. Dank HD Voice in kristallklarer Sprachqualität. Und das Festnetz-Telefon steuert mit den entsprechenden Apps die Rolläden, den Rasensprenger oder die Modellbahn im Keller. Es gibt nur noch eine Fernbedienung für alles. Und die kann mehr als alle bisherigen Fernbedienungen zusammen.
Auch ältere Menschen profitieren von der neuen Technik. Der klassische Hausnotruf könnte zukünftig bequem am Handgelenk getragen werden und sich zu Hause oder unterwegs immer ins beste Netz einbuchen. So schenkt er Mobilität im Alter und kann im Notfall schnell Hilfe rufen - etwa Angehörige, den Hausarzt oder den Rettungsdienst. Und weil im Ernstfall jede Sekunde zählt, übermittelt er dank GPS-Peilung auch gleich seine genaue Position.
Die Idee, die das alles möglich macht, heißt Konvergenz: Das Zusammenspiel aller Dienste und Endgeräte ist mehr als die Summe seiner Teile. Ein zentraler Baustein im neuen konvergenten Netz ist die IP-Technik für das Festnetz. Deshalb baut die Telekom bis 2018 ihr Festnetz um. Bereits über 5 Millionen Kunden nutzen schon jetzt die Vorteile der neuen Technik. Damit hat die Deutsche Telekom den Festnetz-Test 2014 der Fachzeitschrift Connect gewonnen. Das Urteil der Netzexperten: Auch 2014 setzt sich die Deutschen Telekom wieder auf Platz 1. Grundlage dafür sind überzeugende Leistungen in allen getesteten Disziplinen. So sind die Kunden der Telekom auch im Festnetz weiterhin im besten Netz. Schon bald wird es in Deutschland keine Festnetz-Anschlüsse mit alter Technik mehr geben. Die Zeit der Einzelgänger ist vorbei.
Quelle: Deutsche Telekom AG
 Mit freundlicher Zustimmung der Redaktion des BFPT - Bundesverband von Fach- und Führungskräften bei Post und Telekom - Deutsche Postgilde e.V. - entnehmen wir der Mitgliederzeitschrift „Spektrum” Nr. 4/2014 den folgenden Beitrag:
Mit freundlicher Zustimmung der Redaktion des BFPT - Bundesverband von Fach- und Führungskräften bei Post und Telekom - Deutsche Postgilde e.V. - entnehmen wir der Mitgliederzeitschrift „Spektrum” Nr. 4/2014 den folgenden Beitrag:
Keine Angst vor IP
Telekom schaltet bis 2018 das Netz komplett um
von Dipl.-Kfm. Helmut Ludwig
Dezember 2014
Die Deutsche Telekom stellt ihre Kommunikationsnetze auf moderne IP-Technologie um. 3 Millionen Kunden nutzen bereits heute die neuen Anschlüsse. Bis 2018 werden alle 20 Millionen Anschlüsse auf die neue Technologie umgestellt sein. Ein gigantisches Projekt, das Niek Jan van Damme, Deutschland-Chef der Telekom, mit dem Austausch des Schienennetzes der Bahn vergleicht.
Neue Technologie - modern, sicher, günstig. Spätestens nun werden die Alarmglocken entsichert, denken sich die Zweifler und Bewahrer, das wollen wir mal genau wissen. Haben wir nicht schon Lehrgeld bezahlt bei Großprojekten? BER [Berliner Flughafen], Stuttgart 21 usw. Die Fragen sind nicht unberechtigt. Veränderungen in dieser Wirkbreite sind echte Herausforderungen. Störungen im Netzbetrieb blieben in diesem Sommer nicht ohne kritisches Echo. Von der Technologie der Gründerzeit umstellen auf zukunftsorientierte state-of-the-art Technik ist ein Risiko. Am Ende kommen wir jedoch nicht daran vorbei.
Unter dem Titel all-IP (Betrieb aller Telefon-Anschlüsse auf der Basis des Internet-Protokolls) macht sich die Telekom tatsächlich mit zunehmender Vehemenz auf, das gesamte Infrastrukturnetz auf neue Füße zu stellen.
Das klassische Festnetz mit Analog- und ISDN-Anschluss (PSTN, Public Switched Telecom Network) ist quasi dem Tode geweiht. Schon lange hat die Telekom angekündigt, ihr Netz umbauen zu wollen und den Kunden einen Anschluss mit IP-Telefonie zu legen. Und auch die Wettbewerber schalten schon seit Jahren Anschlüsse, bei denen die Telefonie per Internet realisiert wird - nicht nur in Deutschland.
Gute Gründe für den Technologiewechsel
Die gesamte Sprach- und Datenkommunikation wird flexibel, einfach und erlaubt Dienste, die den Umgang mit Telekommunikation bequemer und leichter machen. Mehr Auswahl, besseren Service und höhere Sprachqualität versprechen die Protagonisten. Nicht ohne verbergen zu können, dass der Aufwand zum Betrieb dieser Netze mit erheblichen Kosteneinsparungen verbunden ist. Mit „Plug & Play” können Kunden in der Zukunft ihren IP-basierten Anschluss selbst in Betrieb nehmen. Einstellungen für den Anschluss können ebenso einfach in eigener Regie angepasst werden. Dienste hinzubuchen oder wieder abbestellen - auch von unterwegs, das hat durchaus seine Vorteile. Die gesamte Sprach- und Datenkommunikation wird flexibel, einfach und bequemer.
Was bedeutet das für den Kunden?
Sein Telefon kann er in der Regel auch weiterhin nutzen. Der Betrieb erfolgt über einen Router, der beim normalen Internetbetrieb ohnehin schon lange Standard ist. Es wird lediglich das Netz modernisiert, in dem der Kunde telefoniert. Bisher sprechen wir von einem leitungsbasierten Netz, in dem jeder Telefonanschluss über 2 Kupferadern an die Vermittlungsstelle angeschlossen ist. In Zukunft werden Telefongespräche als „IP Pakete” transportiert. Sie werden dabei immer den schnellsten Weg nehmen. So wie es etwa im Internet und übrigens auch im Mobilfunk schon lange Standard ist. Also keine wesentlichen Veränderungen für den Anschlussinhaber. Alle Drähte bleiben dran.
Die Tatsache, dass der Betrieb unmittelbar an das Stromnetz gekoppelt ist (ein Router ist auf Stromversorgung angewiesen), erweitert die unangenehmen Folgen eines Stromausfalles. Unter Umständen ein gefährliches Risiko besonders bei kritischen und sensiblen Anwendungen, die vom Telefondienst abhängig sind.
Möglicherweise hat der Kunde ja schon lange den neuen Anschluss zu Hause. Falls nicht, sollte sich er sich ermutigen lassen, wenn der Netzbetreiber auf Modernisierung drängt. Als Autor kann ich höchst authentisch eine gute und beruhigende Erfahrung weitergeben: Die Umschaltung ist völlig geräuschlos und ebenso unproblematisch - sogar für Nichttechniker.
Quelle: BFPT
Zum Thema „IP-basierte Telefonie” siehe auch die Beiträge weiter oben in diesen „Stichwörtern”
Die Webseite wird 25 Jahre alt
09.11.2015
- Am 13. November 1990 ging die erste Homepage unter „info.cern.ch” online.
- Jedes 7. deutsche Unternehmen hat keinen eigenen Web-Auftritt.
- Regionale Domains wie „.berlin” sind gefragt.
![]() Vor 25 Jahren veröffentlichte Tim Berners-Lee von der Schweiz aus die erste Webseite. Am 13. November 1990 schaltete der britische Physiker die Homepage info.cern.ch am Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf frei. Heute ist die eigene Homepage zumindest im professionellen Umfeld meist selbstverständlich. 86 Prozent der Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern haben einen eigenen Web-Auftritt. Nur jedes 7. Unternehmen dieser Größenordnung (14 Prozent) besitzt keine Homepage. Bei den kleineren Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten sind allerdings 43 Prozent nicht im Netz vertreten. „Weltweit nutzen über 3 Milliarden Menschen das Internet. Auch Privatpersonen treten immer häufiger mit einer eigenen Webseite auf”, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.
Vor 25 Jahren veröffentlichte Tim Berners-Lee von der Schweiz aus die erste Webseite. Am 13. November 1990 schaltete der britische Physiker die Homepage info.cern.ch am Europäischen Kernforschungszentrum CERN bei Genf frei. Heute ist die eigene Homepage zumindest im professionellen Umfeld meist selbstverständlich. 86 Prozent der Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern haben einen eigenen Web-Auftritt. Nur jedes 7. Unternehmen dieser Größenordnung (14 Prozent) besitzt keine Homepage. Bei den kleineren Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten sind allerdings 43 Prozent nicht im Netz vertreten. „Weltweit nutzen über 3 Milliarden Menschen das Internet. Auch Privatpersonen treten immer häufiger mit einer eigenen Webseite auf”, sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.
Wichtiges Erkennungsmerkmal einer Homepage ist die Adresse, unter der man sie im Internet aufrufen kann. Die mit Abstand häufigste Endung dieser Adresse, auch Top-Level-Domain genannt, ist mit 120 Millionen registrierten Adressen „.com”. Im globalen Vergleich belegt das deutsche „.de” mit 16 Millionen Adressen den 2. Platz. Um die Zahl ansprechender und einprägsamer Adressen zu erhöhen, hat die Vergabestelle ICANN Ende 2013 weitere Domains zugelassen. Mittlerweile existieren mehr als 1.000 verschiedene Endungen für Webadressen. Hinter dem Punkt können inzwischen einprägsame und ungewöhnliche Bezeichnungen folgen, wie etwa „.pizza”, „.ninja” oder „.kiwi”. In Deutschland sind insbesondere regionale Domains beliebt. So gibt es bereits rund 69.000 Adressen mit „.berlin”, fast 25.000 mit „.koeln”, über 31.000 mit „.bayern” und etwa 23.000, die auf „.hamburg” enden. „Gerade regionale Internetadressen eignen sich für kleine Unternehmen, um den individuellen Auftritt im Web direkt mit dem Firmenstandort zu verbinden”, so Rohleder. Das gelte auch für Webseiten zu Veranstaltungen und deren Austragungsort wie bei www.hub.berlin.
Als Ursprung aller Webseiten war die Homepage des CERN vor 25 Jahren der erste Zugangspunkt zum World Wide Web (WWW), einem Netzwerk, das den Datenaustausch unter den Wissenschaftlern vereinfachen sollte. Die ursprüngliche Seite erklärte, was das WWW ist, wer es erschaffen hat und wie man es nutzt. Unter info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html gibt es eine Kopie der ersten Webseite aus einfachem Text. Was mit dieser schlichten Seite begonnen hat, hat sich im Informationswesen fest etabliert. Alleine in Deutschland nutzen 80 Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren das World Wide Web. Selbst für einen Großteil der Älteren ist die Internetnutzung selbstverständlich: 84 Prozent der 50- bis 65 jährigen Bundesbürger sowie 37 Prozent der über 65-Jährigen nutzen heute das Internet. Im Januar 2014 waren es erst 74 bzw. 26 Prozent.
Siehe auch: http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben zu Unternehmen mit eigener Homepage sind Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Für den europäischen Vergleich wurden Unternehmen ab 10 Beschäftigten sowie Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten (jeweils ohne den Bankensektor) in 31 europäischen Ländern befragt. Die Zahlen zu Top-Level-Domains beruhen auf Daten der DENIC eG und Angaben der dotBERLIN GmbH & Co. KG. Grundlage der Angaben zu Internetnutzern in Deutschland sind repräsentative Befragungen von Bitkom Research im Auftrag des Bitkom. Die Begriffe Homepage, Webseite und Web-Auftritt werden hier synonym verwendet.
Über BITKOM
Bitkom vertritt mehr als 2.300 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, davon gut 1.500 Direktmitglieder. Sie erzielen mit 700.000 Beschäftigten jährlich Inlandsumsätze von 140 Milliarden Euro und stehen für Exporte von weiteren 50 Milliarden Euro. Zu den Mitgliedern zählen 1.000 Mittelständler, 300 Start-ups und nahezu alle Global Player. Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder Internetdienste an, stellen Hardware oder Consumer Electronics her, sind im Bereich der digitalen Medien oder der Netzwirtschaft tätig oder in anderer Weise Teil der digitalen Wirtschaft. 78 Prozent der Unternehmen haben ihren Hauptsitz in Deutschland, 9 Prozent kommen aus Europa, 9 Prozent aus den USA und 4 Prozent aus anderen Regionen. Bitkom setzt sich insbesondere für eine innovative Wirtschaftspolitik, eine Modernisierung des Bildungssystems und eine zukunftsorientierte Netzpolitik ein.
◊






